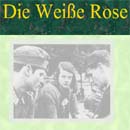zur katholischen Geisteswelt
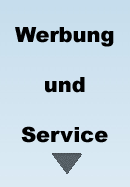
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im philosophischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Atheismus
Atheisten
Atheist. Moral I
Atheist. Moral II
Aufklärung
Autonomie
Autonomiebuch
Biologismus
Entzauberung
Ethik
Euthanasie
Evolutionismus
Existenzphil.
Gender
Gewissen
Gewissen II
Glück
Glück und Wert
Gottesbeweis
Gottesglaube
Gotteshypothese
Handlung
Handlungsmotive
Das Heilige
Kultur
Kulturrelativismus
Langeweile
Liebe
Liebe II
Liebesethik
Menschenwürde
Metaethik
Methodenfrage
Moralillusion
Naturalismus
Naturrecht
Naturrecht II
Naturrecht III
Neurologismus
Opferidee
Philosophie
Proslogion
Relativismus
Sinnparadox
Sittengesetz
Sollen
Theodizee
Tierschutz
Verantwortung
Vernunftphil.
Vernunftrettung
Voluntarismus
Werte
Wirklichkeit
Von P. Engelbert Recktenwald
Der bekannte Psychiater Viktor E. Frankl schreibt in einem seiner Bücher von einem Wagnis, das nur der religiöse Mensch leiste (“Der unbewußte Gott”). Der irreligiöse Mensch schrecke davor zurück, “weil er den ‘festen Boden unter den Füßen’ nicht missen” wolle. Welches Wagnis meint Frankl? Er spricht vom Gewissen als dem “Wovor des Verantwortlichseins” und vergleicht es mit einem Gipfel, zu dem der Mensch gelangt, wenn er sich auf den Weg zur Sinnfindung macht. Aber dieser Gipfel ist nur ein Vorgipfel. Der irreligiöse Mensch macht hier halt, weil er sich nicht weiter voranwagt ins Ungewisse hinein, zum eigentlichen Gipfel, der vom Nebel verhüllt ist. Dieser eigentliche Gipfel ist Gott. Er ist die letzte Instanz, vor der wir uns verantworten müssen.
Tatsächlich: Das Gewissen würde seine Autorität uns gegenüber einbüßen, wenn es nicht eine transzendente Autorität repräsentieren würde. Frankl: “Hinter dem Über-Ich des Menschen steht nicht das Ich eines Übermenschen, sondern das Du Gottes. Denn nie und nimmer könnte das Gewissen ein Machtwort sein in der Immanenz, wäre es nicht das Du-Wort der Transzendenz.”
Genau so sieht es auch der hl. John Henry Newman. In seinem “Grammar of Assent” schreibt er: “Wenn wir, wie es ja der Fall ist, uns verantwortlich fühlen, beschämt sind, erschreckt sind bei einer Verfehlung gegen die Stimme des Gewissens, so schließt das ein, dass hier Einer ist, dem wir verantwortlich sind, vor dem wir beschämt sind, dessen Ansprüche an uns wir fürchten.”
Wir erfahren das Gewissen als eine Instanz, die unsere Handlungen unbestechlich richtet. Diese Erfahrung ist allgemeinmenschlich und in der Geistesgeschichte immer wieder formuliert worden. Der hl. Johannes Chrysostomus etwa spricht vom Gewissen als einem Richterstuhl, Rousseau nennt es einen “unbestechlichen Richter über das Gute und Böse”.
Doch woher hat das Gewissen seine Autorität? Wir stehen vor der Wahl, diese Autorität entweder ernst zu nehmen oder nicht. Wenn wir sie ernst nehmen, müssen wir über das Gewissen hinausfragen. Wir können es nicht als ein bloß psychisches Phänomen abtun. Letzteres würde das Leben natürlich bequemer machen. Dann bräuchten wir es mit der Entscheidung zwischen Gut und Böse nicht so genau zu nehmen. Denn das Gewissen wäre ein ohnmächtiger Richter. Streng genommen wäre die Art und Weise, wie es sich uns präsentiert, ein einziger Bluff. Es tut so, als wären wir für unser Tun rechenschaftspflichtig, aber in Wirklichkeit würde es nie zu dieser Rechenschaft kommen. Das Gewissen bliebe ein Papiertiger. Sich mit einem Papiertiger herumzuschlagen, ist kein Wagnis.
Es ist interessant zu sehen, wie Frankl hier ein Narrativ der Religionskritik geradezu auf den Kopf stellt. Nicht der Glaube an Gott, sondern seine Leugnung ist eine Wunschprojektion. Während der Religionskritiker Ludwig Feuerbach noch meinte: “Der Wunsch ist der Ursprung... weiterlesen im Buch "Am Ende wartet Gott".
Der Synodale Weg auf dem Prüfstand des Römerbriefes
In dieser Predigt zum 7. Sonntag nach Pfingsten gehe ich auf die Lesung ein: Röm, 6, 19-23. Dort stellt der hl. Paulus den Gegensatz heraus, durch den sich die Lebensweise der Christen von der ihrer heidnischen Umwelt abhob. Diesen Gegensatz will der Synodale Weg wieder aus der Welt schaffen, indem die heutige Lebenswirklichkeit zur Norm erhoben wird. Dies geschieht im Namen der autonomen Moral. Der “Vater der autonomen Moral”, Alfons Auer, ging in seinem bahnbrechenden Werk davon aus, dass Christus keine neuen moralischen Normen brachte, dass also das christliche Ethos keine radikal neue Lebensweise zur Folge hatte, sondern lediglich das vorgefundene Weltethos in einen neuen Sinnzusammenhang stellte. Das ist das Gegenteil der Botschaft des hl. Paulus in der Lesung dieses Sonntags.
Philosophen
Anselm v. C.
Bacon Francis
Bolzano B.
Ebner F.
Geach P. T.
Geyser J.
Husserl E.
Kant Immanuel
Maritain J.
Müller Max
Nagel Thomas
Nida-Rümelin J.
Pieper Josef
Pinckaers S.
Sartre J.-P.
Spaemann R.
Spaemann II
Tugendhat E.
Wust Peter
Autoren
Bordat J.
Deutinger M.
Hildebrand D. v.
Lewis C. S.
Matlary J. H.
Novak M.
Pieper J.
Pfänder Al.
Recktenwald
Scheler M.
Schwarte J.
Seifert J.
Seubert Harald
Spaemann R.
Spieker M.
Swinburne R.
Switalski W.
Wald Berthold
Wust Peter