zur katholischen Geisteswelt
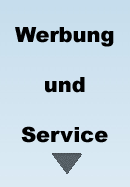
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im philosophischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Atheismus
Atheisten
Atheist. Moral I
Atheist. Moral II
Aufklärung
Autonomie
Autonomiebuch
Biologismus
Entzauberung
Ethik
Euthanasie
Evolutionismus
Existenzphil.
Gender
Gewissen
Gewissen II
Glück
Glück und Wert
Gottesbeweis
Gottesglaube
Gotteshypothese
Handlung
Handlungsmotive
Das Heilige
Kultur
Kulturrelativismus
Langeweile
Liebe
Liebe II
Liebesethik
Menschenwürde
Metaethik
Methodenfrage
Moralillusion
Naturalismus
Naturrecht
Naturrecht II
Naturrecht III
Neurologismus
Opferidee
Philosophie
Proslogion
Relativismus
Sinnparadox
Sittengesetz
Sollen
Theodizee
Tierschutz
Verantwortung
Vernunftphil.
Vernunftrettung
Voluntarismus
Werte
Wirklichkeit
Rationalität und Gottesglaube
Von Prof. Dr. Robert Spaemann
Platon hat zur Deutung der Situation des Menschen in der Welt ein Gleichnis erfunden, das sogenannte Höhlengleichnis. Ganz vereinfacht sieht das so aus: Menschen sitzen in einer fensterlosen Höhle. Sie sitzen angekettet einer Wand gegenüber. Auf der Wad wird ein Schattenspiel gegeben, ein Höhlenkino. Hinter dem Rücken der Angeketteten ist eine künstliche Lichtquelle, vor der Figuren hin- und herbewegt werden, die ihre Schatten auf die Wand werfen. Die Menschen kennen keine andere Situation als diese. Sie können einander und auch sich selbst nicht sehen, sondern nur das Schattenspiel. Dieses Spiel gilt ihnen deshalb als die einzige Wirklichkeit. Mit Bezug auf diese ereifern sie sich, stellen Vermutungen an über den Fortgang des Dramas, stellen Theorien auf und machen Prognosen. Zwar geistert das Gerücht herum, es gebe so etwas wie eine wahre Welt außerhalb der Höhle und es gebe die Möglichkeit, sich zu befreien und dorthin zu gelangen. Aber man hat von solchen gehört, die dorthin gelangten und deren Augen von dem Sonnenlicht so geblendet wurden, dass sie gar nichts sahen, falls sie nicht die Geduld hatten, die Anpassung der Augen abzuwarten. Die Höhlenbewohner sträuben sich deshalb mit Händen und Füßen, wenn einer von draußen zurückkommt, um sie zu befreien.
Platons Absicht ist es, mit diesem Gleichnis die Welt der Ideen als die eigentliche Wirklichkeit und die materielle Welt als deren bloßes Abbild darzustellen. Aber wir können das Gleichnis leicht ein bisschen abwandeln, ohne uns von Platons Intention weit zu entfernen. Die Sonne ist nämlich für Platon das Bild des substantiellen Guten, des höchsten Gutes, das alles Streben in der Welt letzten Endes motiviert und das die Kirchenväter später mit Gott gleichgesetzt haben, – nicht zu Unrecht, denn Platon sagt, das Gute selbst sei Grund sowohl der Wirklichkeit der Dinge als auch ihrer Erkennbarkeit, also der Wahrheit. In meiner Abwandlung des Gleichnisses sind wir selbst nicht nur die Betrachter des Höhlenkinos, sondern die Mitspieler im Film. Unsere Wirklichkeit verdankt sich in jedem Augenblick dem Licht eines schöpferischen Projektors und seinem Filmstreifen. Schöpferisch nenne ich ihn deshalb, weil er Dinge und Lebewesen projiziert, die tatsächlich belebt und sogar in gewissem Rahmen frei sind, sich so oder so zu bewegen. Würde allerdings das Licht erlöschen, wäre der Film und mit ihm alle Figuren darin verschwunden. Sie würden nicht sterben, denn sterben ist ja selbst noch ein Geschehen im Film und hat Ursachen, die ihrerseits zum Film gehören: Krankheit, Unfall, Mord usw. Das Abreißen des Filmstreifens ist nicht ein Teil des Films. Innerhalb des Films aber gibt es auch eine Vergangenheit, die wir extrapolieren. Wir wissen, dass das Kind, das wir sehen, nicht nur die Eltern hat, die wir auch sehen, sondern, wie jedes Kind auch Großeltern und Urgroßeltern. Und wir können aufgrund der Beobachtungen innerhalb des Films auch großangelegte physikalische Theorien über die Vergangenheit der Welt und über ihre Kausalgesetze entwickeln. Der Projektor mit dem Streifen, der die eigentliche Ursache des Ganzen ist, taucht natürlich im Film nicht auf. Der Urknall gehört z.B. noch zum Film und auch das, was eventuell vor dem Urknall war. Der Projektor aber kommt in der Kette der Ursachen nirgends vor, auch nicht am Anfang. Er ist vielmehr Grund und Ursache der ganzen Kette und jedes einzelnen ihrer Glieder. Das Wort «Ursache» hat nicht die gleiche, sondern nur eine analoge Bedeutung, wenn wir es auf innerweltliche Antecedensbedingungen und wenn wir es auf Gott beziehen.
Was ich hier beschreibe, ist ein Bild dessen, was das Wort «Schöpfung» bedeutet. Es bedeutet nicht ein Anfangsereignis innerhalb der irdischen Wirklichkeit, ein Ereignis, auf das wir vielleicht irgendwann bei unseren Forschungen stoßen werden. Es bedeutet vielmehr, dass der ganze Weltprozess und jedes kleinste Ereignis in ihm seinen wahren Grund in einem außerhalb dieses Prozesses liegenden schöpferischen Willen hat.
Dass es sich so verhält, sagt ein altes Gerücht, das Gerücht von Gott. Merkwürdigerweise waren die Menschen nie so total in die «innerfilmische», d.h. innerweltliche Wirklichkeit versenkt, dass sie für dieses Gerücht vollkommen unzugänglich gewesen wären. Ihr Bedürfnis, die Wirklichkeit zu verstehen, wurde durch das, was sie sahen, nicht befriedigt. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, der Vater der modernen analytischen Philosophie, schreibt einmal, es sei der Aberglaube der Moderne, die Naturgesetze erklärten uns die Naturereignisse, während sie doch nur strukturelle Regelmäßigkeiten beschreiben. Diese Regelmäßigkeiten erklären weder das, was geschieht, noch sich selbst. Sie haben nichts logisch Zwingendes, wie die Sätze der Mathematik, auch wenn sie sich mathematisch formulieren lassen. Dass sie sich mathematisch formulieren lassen, ist vielmehr selbst gerade für die Naturwissenschaftler, wie z.B. für Einstein, immer ein Grund des Staunens und der Hinweis auf einen göttlichen Ursprung gewesen. Kant nannte es einen Grund immerwährenden Staunens, dass es überhaupt Naturgesetze gibt. Es versteht sich nicht von selbst und beendet nicht die Suche nach dem, was sich wirklich von selbst versteht und was wir «Gott» nennen.
Dennoch gehört gerade der Fortschritt der modernen Wissenschaft zu den Ursachen, die das Gerücht von Gott verdrängen. Das hängt einmal zusammen mit der raschen Erweiterung des Bereichs des Machbaren, der uns das rauschhafte und irrige Gefühl der Unendlichkeit gibt, andererseits mit der exponentiell wachsenden Geschwindigkeit der Veränderung unserer Lebensverhältnisse. Dadurch wird unsere Aufmerksamkeit so stark auf die immer neue Anpassung an die diesseitige Wirklichkeit fixiert, dass die Frage nach Grund und Sinn des Ganzen, also nach einem Außerhalb der Höhle als etwas erscheint, das wir uns nicht mehr leisten können. Mit den tatsächlichen Aussagen der Wissenschaften hat das eigentlich nichts zu tun. Von den Wissenschaften selbst wurde bisher kein einziges ernsthaftes Argument gegen das Gerücht von Gott vorgebracht, sondern nur von der sogenannten wissenschaftlichen Weltanschauung, also dem, was Wittgenstein den Aberglauben der Moderne nennt. Die Wissenschaft ist die Bedingungsforschung. Sie fragt nicht, was etwas ist, sondern was die Bedingungen seiner Entstehung sind. Und sie fragt es, weil wir durch Kenntnis dieser Bedingungen instand gesetzt werden, selbst in den Lauf der Dinge einzugreifen. Dieser Typus von Wissenschaft ist durch den Willen zur Naturbeherrschung bestimmt. Eine Sache kennen, heißt, wie Thomas Hobbes schreibt, «to know, what we can do with it when we have it». Die sog. wissenschaftliche Weltanschauung aber, der Szientismus, glaubt, wir hätten verstanden, was etwas ist, wenn wir verstanden haben, wie es entstanden ist. Also z.B. wer wir sind, wenn wir wissen, wer unsere Vorfahren waren, was Erkenntnis oder was Schmerz ist, wenn wir deren biologische Funktion und damit ihren evolutionären Selektionsvorteil verstanden haben und wenn wir die hirnphysiologischen Prozesse kennen, die die Infrastruktur dieser Phänomene bilden. Die Absurdität dieser szientistischen Weltanschauung können wir uns klar machen, wenn wir uns vorstellen, wir hätten das Feuern der C-Fasern im Gehirn, das empirisch allen Schmerzen zugrunde liegt, zur Definition dessen, was Schmerzen sind, erklärt. Und nun käme ich zum Arzt wegen irgendwelcher starker Schmerzen, der Neurologe untersuchte mich und stellte eben jene physiologischen Prozesse nicht fest, die sonst mit Schmerzen verbunden sind. Und stellen wir uns nun vor, der Arzt erklärte mir: «Sie haben keine Schmerzen. Schmerzen bestehen in dem Feuern von C-Fasern, und Ihre C-Fasern feuern nicht». Jeder von uns würde ja doch wohl antworten: «Lieber Doktor, das mit den C-Fasern mag ja sein wie es will. Aber ob ich Schmerzen habe, muss ja wohl ich selbst wissen. Und wenn Sie es mir unmöglich gemacht haben, mich artikuliert über meine Schmerzen zu äußern, da Sie durch Umdefinition mir das Wort Schmerz weggenommen haben, dann muss ich eben schreien.»
Wissenschaft ist Bedingungsforschung. Selbstsein ist Emanzipation von den Entstehungsbedingungen. Und das Unbedingte kann per definitionem innerhalb der Bedingungsforschung nicht vorkommen. Gott aber ist per definitionem das Unbedingte. Wenn ich sagte, der Fortschritt der Wissenschaft habe das Gerücht von dem Unbedingten zurückgedrängt, so nicht deshalb, weil die Wissenschaft irgendein Argument gegen dieses Gerücht vorgebracht hätte. Der Grund ist eher ein psychologischer: Der wissenschaftliche Fortschritt hat sozusagen einen Verblüffungseffekt. Er übt Faszination aus. Er erweckt den Eindruck, dass Wissenschaft schließlich eben doch alles erklären werde, obwohl dieser Gedanke so absurd ist, als warte man in einem Film darauf, dass schließlich doch der Film sich selbst erkläre und damit den Projektor überflüssig mache.
Nein, die Alternative kann nie lauten: wissenschaftliche Erklärbarkeit der Welt oder Gottesglaube, sondern nur: Verzicht auf Verstehen der Welt, Resignation der Vernunft oder Gottesglaube. Der Rationalismus der Aufklärung ist innerhalb des Szientismus längst dem Glauben an die Ohnmacht der menschlichen Vernunft gewichen, dem Glauben, dass wir nicht das sind, wofür wir uns halten: vernünftige, freie selbstbestimmte Wesen. Der christliche Glaube hat den Menschen zwar nie für so vernünftig und so frei gehalten, wie es die Aufklärung des 18. Jahrhunderts tat. Er hält ihn aber auch nicht für so unvernünftig und so unfrei, wie es der heutige Szientismus tut. Und er traut der Vernunft, der ratio, eine größere Reichweite zu als der Szientismus. Ratio heißt sowohl Vernunft wie Grund. Die wissenschaftliche Weltanschauung hält die Welt und damit auch sich selbst für grundlos und irrational. Der Glaube an Gott ist der Glaube an einen Grund der Welt, der selbst nicht grundlos, also irrational ist, sondern «Licht», für sich selbst durchsichtig und so sein eigener Grund.
Damit bin ich beim zweiten Teil, nämlich bei der Frage: Was glaubt, wer an Gott glaubt? In einem dritten Teil möchte ich über die Gründe sprechen, die uns unter den spezifischen Bedingungen der Gegenwart veranlassen können, an die Existenz Gottes zu glauben.
Was glaubt, wer an Gott glaubt? Er glaubt, so sagte ich, an eine fundamentale Rationalität, er glaubt, dass das Gute fundamentaler ist als das Böse, er glaubt, dass das Niedrigere vom Höheren kommt und nicht umgekehrt, dass Unsinn Sinn voraussetzt und dass Sinn nicht eine Variante des Unsinns ist. Abstrakter, weniger rhetorisch heißt das: Mit dem Begriff «Gott» denken wir die Einheit, ja die Identität der Referenz zweier Prädikate, die in unserer irdischen Erfahrungswelt nur manchmal und niemals notwendig miteinander verbunden sind: die Einheit des absolut Mächtigen und des absolut Guten, also die Einheit von Sein und Sinn. Diese Einheit ist nicht eine analytische Wahrheit, d.h. sie ergibt sich nicht aus den bloßen Begriffen. Unsere Worte «mächtig» und «gut» haben, um an ein Beispiel des großen Philosophen und Mathematikers Frege anzuknüpfen, so wenig denselben Sinn wie die Worte «Abendstern» und «Morgenstern». Die Menschen haben Jahrtausende lang einen Abendstern und einen Morgenstern gekannt, ehe sie entdeckten, dass beide Sterne in Wirklichkeit einer und derselbe sind, die Venus. Die Worte «Abendstern» und «Morgenstern» haben einen verschiedenen Sinn, aber dieselbe Bedeutung, wie Frege sich ausdrückte, oder dieselbe «Referenz», wie man heute meistens sagt. So haben für uns die Worte «gut» und «mächtig» verschiedenen Sinn. Wer an Gott glaubt, der glaubt, dass die absolute Macht, die Allmacht, wie wir sagen, und das absolut Gute dieselbe Bedeutung haben: den heiligen Gott. Wir denken im Gedanken «Gott» zwei Unbedingtheiten zusammen, die in unserer Erfahrung voneinander verschieden sind. Das eine ist die Unbedingtheit des Faktischen. «Wie sich alles verhält, ist Gott. Gott ist, wie sich alles verhält» heißt es bei Wittgenstein. Gegen das, was ist, wie es ist, gibt es keinen Einspruch. «Ducunt fata volentem nolentem trahunt», lautet ein Spruch der Stoiker. «Den Willigen leitet das Schicksal, den Widerstrebenden schleift es mit». «Inschallah», «wenn Gott will», sagen die Moslems, wenn sie eine Absicht kundtun. Der Brief des Apostels Jakobus empfiehlt uns dasselbe. Der Gläubige nimmt alles, was ihm zustößt, aus der Hand Gottes entgegen, unter Umständen so, dass er mit Gott hadert. Als Hiob mit Gott hadert wegen des Unglücks, das über ihn gekommen ist, wollen sein Freunde ihm klarmachen, dass Gott gerecht ist und dass er selbst in sich gehen und bei sich selbst den Grund für sein Unglück suchen soll. Hiob sieht das nicht ein, und Gott selbst weist die Freunde zurecht wegen ihrer Weise, Gott zu Hilfe zu kommen. Wenn Gott Hiob zum Schweigen bringt, dann nicht, indem er sich ihm gegenüber rechtfertigt, sondern indem er sagt: «Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist.... Wer mit dem Allmächtigen rechtet, kann der ihm etwas vorschreiben? ... Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? ...» Und darauf Hiobs Antwort: «Ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe ... Ich hatte dich nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.» Bedingungslose Unterwerfung unter den Willen Gottes, der sich in dem zeigt, was geschieht und was wir nicht ändern können, ist die erste und fundamentale Haltung aller, die an Gott glauben. Aber was heißt hier Unterwerfung gegenüber dem, was wir sowieso nicht ändern können? Ist es nicht menschenwürdiger, dem, was wir nicht ändern können, wenigstens unsere Zustimmung zu verweigern? Nur, wenn wir annehmen, dass Gott nicht existiert, das Schicksal blind und das Universum gleichgültig ist gegen unsere Zustimmung ebenso wie gegenüber unserem Protest, dann sind Zustimmung ebenso wie Protest im Grunde sinnlos und es bleibt nur ein tierisches Sich-Fügen. Hiobs Protest hat ja überhaupt nur Sinn, weil Hiob Gott als ein Wesen denkt, zu dem es gehört, gut zu sein. Und eben deshalb verteidigt Gott ja auch den Hiob gegen seine frommen Freunde. Im Protest liegt ja noch eine Anerkennung dessen, bei dem man Protest einlegt. Hielte man ihn für böse oder gleichgültig gegen irdisches Leid, dann hätte es keinen Sinn zu protestieren. Die Psalmen bitten Gott immer wieder, uns zu Hilfe zu kommen «um seines Namens willen». Gott, das steht dahinter, ist es sozusagen sich selbst schuldig, seinem Volk zu Hilfe zu kommen. Und wenn Léon Bloy schreibt: «Tout ce qui arrive est adorable», dann doch nur deshalb, weil er gegen allen Augenschein glaubt, dass das, was geschieht, seinen letzten Ursprung in einem unendlich guten, das heißt, in einem heiligen Willen hat. Und anders wäre auch der Islam nicht zu verstehen.
Es ist wichtig, das heute besonders zu betonen, wo oft sogar Priester statt den Segen des allmächtigen Gottes auf uns herabzurufen nur vom guten Gott sprechen. Die Rede vom lieben Gott und die Botschaft davon, dass Gott die Liebe ist, verliert ja ihre überwältigende Pointe, wenn sie vergessen macht, von wem hier gesagt wird, er sei die Liebe, nämlich von der absoluten, die Welt und unser Dasein tragenden Macht. Die Gnostiker der ersten Jahrhunderte haben genau diese Pointe des christlichen Glaubens beseitigt, indem sie die beiden Prädikate auf zwei Götter verteilten, eine böse Macht, die diese Welt hervorgebracht hat, und ein Licht, das von Ferne in die Finsternis leuchtet. Der Glaube an Gott ist der Glaube, dass von diesem Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, das Wort des Johannesevangeliums gilt: «Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden.»
Ich sprach von der einen Unbedingtheit, die wir im Begriff Gottes denken, die Unbedingtheit des Faktischen, des Schicksals. Die andere Unbedingtheit ist die des Guten, die sich uns kundtut nicht oder doch nur manchmal in dem, was geschieht, sondern in der leisen, aber unerbittlichen Stimme des Gewissens. Sie wurde von denen, die an Gott glauben, immer als Stimme Gottes verstanden, wenngleich hier auch Täuschungen möglich sind, wie bei jeder Stimme. Für Thomas von Aquin ist die Stimme des Gewissens, durch die Gott spricht, nichts anderes als die Stimme der praktischen Vernunft, und auch die Vernunft bedarf der Orientierung und Korrektur, um das zu sein, was sie ist: vernünftig. Aber ihr Spruch ist inappellabel. Dieser inappellable Spruch aber scheint uns nur zu oft im Widerspruch zu stehen zu dem, was faktisch geschieht. Was geschieht, ist oft das Böse und Unvernünftige. Und keine Macht der Welt kann uns zwingen, das Böse gut zu nennen und das Gute böse. Wer an Gott glaubt, glaubt, dass beide Unbedingtheiten, das Sein und das Gute, im letzten Grund eins sind. Und wenn wir Gott den verborgenen nennen ("vere tu es deus absconditus" schreibt Pascal), dann deshalb. Das Faktische, die unbedingte Macht dessen, was ist, wie es ist, und geschieht, wie es geschieht, ist ja nicht verborgen, sondern offenbar. Und das Gute ist uns auch nicht verborgen, sondern Vernunft und Gewissen machen es uns bekannt. "Notas fecisti vias vitae", "du hast mir die Wege des Lebens bekannt gemacht" – der Psalmvers steht über dem Hochaltar des Salzburger Doms. Wenn wir Gott den verborgenen nennen, dann deshalb, weil uns die heilige Einheit von Allmacht und Liebe nicht sichtbar ist. Von einer Coincidentia oppositorum, einer Einheit der Gegensätze sprach der große deutsche Philosoph Nikolaus Cusanus. Und übrigens ist es so: Wenn wir eine der beiden Unbedingtheiten konsequent zuende denken, sind wir genötigt, die andere mitzudenken. Der Inbegriff, das Ganze dessen, was geschieht, die Gesamtheit dessen, was der Fall ist, wäre das alles nicht, wenn die sittlichen Überzeugungen, wenn die Stimme des Gewissens dabei nicht mitgedacht würde. Die absolute Macht hätte für sie unüberwindliche Grenzen, wäre also nicht absolut, wenn sie für immer ein stilles, unerbittlich richtendes Auge sich gegenüber hätte. Wenn das Gute nicht zum Sein gehörte, wäre das Sein nicht das Sein, also alles. Aber auch das Umgekehrte gilt: Die Unbedingtheit des Guten wäre nicht unbedingt, wenn sie nicht den Willen einschlösse, sich handelnd in die faktische Welt einzufügen in der Erwartung, dass dieses Handeln nicht aufgrund der Absurdität der Wirklichkeit von vornherein zur Absurdität verurteilt wäre. Fichtes Schrift "über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung" hat genau diese Pointe. Das Gute gehört zum Sein, aber das Sein gehört ebenso zu dem Guten. Beides denken wir im Begriff Gottes. Aber innerhalb der einen Seite des Prädikatenpaares "wirklich" und "gut" gibt es für uns noch einmal eine solche Antinomie, nämlich im Begriff des Guten und der Liebe selbst. Wir denken Gott als den Gerechten, als den Ort der absoluten und endgültigen Gerechtigkeit. Die Tränen und Schreie der Opfer in der Kette des Unrechts bleiben bei ihm nicht ungehört. "Nil inultum remanebit", "nichts bleibt ungerächt", so heißt es im Dies irae. Aber wir denken ihn zugleich als Ort der absoluten Barmherzigkeit und Verzeihung, die alle menschlichen Maße sprengt. Die Identität von Gerechtigkeit und erbarmender Güte, die wir im Begriff der absoluten Güte denken, bleibt unserer Vorstellungskraft verborgen. Nur im Opfer Christi lichtet sich für den Gläubigen das Dunkel. Denn dieses Opfer bedeutet, dass Gott selbst, um ohne Unrecht gegen die Opfer des Bösen verzeihen zu können, sich selbst zum Opfer machte und sich so zum Verzeihen ermächtigte. Aber dies ist eine andere Geschichte, von der hier nicht die Rede sein soll, die Geschichte vom Eintritt des Projektors in den Film, des Schöpfers in die Schöpfung, den das Christentum lehrt. Es lehrt damit nicht einen anderen Gott als den Israels und des Islam, aber es macht den Verborgenen offenbar. "Ihr nennt ihn euren Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Ich aber kenne ihn. Und würde ich sagen, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, so wie ihr", sagt Jesus im Johannesevangelium.
Die beiden Unbedingtheiten, die wir im Begriff Gottes denken, ohne sie begreifen zu können, hat Thomas von Aquin im Auge, wenn er von den zwei Willen Gottes spricht: dem einen, der sich in dem manifestiert, was geschieht, und dem anderen, der sich bezieht auf das, wovon er will, dass wir es wollen, also – so können wir sagen – seinem Geschichtswillen und seinem Gebotswillen. Der erste Wille ist uns verborgen, ehe das Geschehene geschehen ist, der zweite ist uns jederzeit bekannt. Den ersten dürfen wir gar nicht zu wollen versuchen, wir können uns ihm nur unterwerfen. Den zweiten sollen wir uns zu eigen machen und ihm gehorchen. Thomas gibt ein Beispiel: Ein Mann hat ein Verbrechen begangen. Der Gebotswille Gottes macht es dem Inhaber der staatlichen Gewalt zur Pflicht, nach dem Verbrecher zu fahnden, um ihn zu bestrafen. Er macht es der Frau des Verbrechers zur Pflicht, ihrem Mann behilflich zu sein, wenn er sich verstecken will. Die Verantwortlichkeiten der beiden sind verschieden, und nur Gott ist zuständig für das Universum und für das, was letzten Endes geschieht. "Wenn ihr alles getan habt", sagt Jesus, "dann sprecht: 'Wir sind unnütze Knechte'".
Der absolute, der Geschichtswille Gottes zeigt sich in dem, was dann wirklich geschieht, also darin, ob der Mann gefasst wird oder nicht. Beide, der König und die Frau, haben das endliche Resultat mit Ergebung anzunehmen, und keiner darf den anderen an der Erfüllung seiner Pflicht hindern. Der König darf die Frau nicht bestrafen, wenn sie ihren Mann versteckt, Kreon darf Antigone nicht bestrafen, weil sie ihren Bruder begräbt, und die Frau darf nicht zur Terroristin werden und den König umbringen, weil er ihren Mann bestraft. Der Geschichtswille Gottes verwirklicht sich in einer für uns undurchschaubaren Weise mit Hilfe ständiger Übertretungen seines Gebotswillens. "O wahrhaft notwendige Sünde Adams", so singt die Kirche in der Osternacht, "die uns einen solchen Erlöser beschert hat". Heißt das, dass Gott die Sünden will? Natürlich nicht. Aber sie dienen dennoch seinem Willen. Sie sind, wie Mephisto in Goethes Faust sagt, "ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft". Gott ist ein Maler, in dessen Gemälde ein Bösewicht immer wieder Farbkleckse wirft, und der jeden dieser Kleckse benutzt, um aus ihm noch eine bessere Variante des Bildes zu machen. Am Ende muss man sagen: All diese Kleckse waren notwendig, um dieses vollkommene Bild zustande zu bringen, so wie der Verrat des Judas notwendig war, um unsere Erlösung in der Form zu bewirken, in der sie stattfand. Was nicht heißt, dass Gott nicht auf andere Art auch zu seinem Ziel gekommen wäre. Aber das Bild wäre dann eben ein anderes Bild geworden.
Jeder Versuch, mit dem göttlichen Geschichtswillen unmittelbar zu konspirieren, führt zum Ungehorsam gegen seinen Gebotswillen. "Der Menschensohn muss zwar verraten werden, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird", sagt Jesus mit Bezug auf den Verrat des Judas.
Was glaubt, wer an Gott glaubt? Er glaubt an ein Unbedingtes, ein Sein, das seinen Grund in sich selbst hat, weil es das schlechthin Sinnvolle, sich selbst Genügende ist. Die christliche Trinitätslehre vollendet den Begriff Gottes, indem sie Gott als allmächtige Liebe denkt. Und zwar wesenhaft in sich selbst Liebe, sodass er nicht einer Welt und des Menschen bedarf, um sein Wesen als Liebe zu verwirklichen. In diesem Fall nämlich wäre Gott nicht Gott, nicht in sich bereits das Ganze, sondern Gott allein wäre weniger als Gott und Welt zusammen, so als würde das Spiegelbild einer Kerze dem Licht der Kerze etwas an Helligkeit hinzufügen. Die Welt wäre dann auch nicht freie Schöpfung Gottes, sondern sie wäre notwendig, um einen Mangel Gottes zu beheben. Gott ist in sich selbst Liebe, das heißt: Er ist in sich reflektiert, er hat ein adäquates Bild von sich in sich selbst, ein lebendiges Gegenüber, den Logos. Und die Selbstübereignung in Liebe an den Logos, den Sohn, geschieht in einer Gabe, die wiederum Gott selbst ist, das heilige Pneuma, oder, wie wir im Westen sagen, den Heiligen Geist. Die Mysterien des Christentums, einmal offenbart, erweisen sich als Vollendung dessen, was die Vernunft nur dunkel erahnen kann.
Das Gerücht von Gott liegt überall, wo Menschen sind, in wie deformierter Gestalt auch immer, in der Luft. In der griechischen Philosophie wird es erstmals begrifflich gedacht, in Israel verliert es erstmals selben Charakter des Gerüchts und wird zu einer gemeinschaftlichen Glaubenserfahrung, bis dann innerhalb Israels Jesus von Nazareth auftritt und sagt: "Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen". Aber die Frage bleibt: Entspricht diesem Gerücht etwas in der Realität? Wir wissen, was wir meinen, wenn wir "Gott" sagen. Wir haben, wie Kant sagt, ein fehlerfreies Ideal von diesem höchsten Wesen, einen "Begriff, welcher die ganze menschliche Erfahrung schließt und krönet". Aber welchen Grund haben wir zu glauben, dass diesem Begriff, wie wiederum Kant sagt, "objektive Realität" zukommt? Welchen Grund haben wir zu glauben, dass Gott mehr ist als eine Idee, welchen Grund haben wir zu glauben, dass er existiert?
Es gibt die negative Antwort auf diese Frage, den Atheismus, es gibt die bekümmerte Feststellung, eine Antwort bisher nicht gefunden zu haben, oder die agnostische Antwort, man könne eine solche Antwort aus prinzipiellen Gründen nicht finden. Alle diese Antworten, so falsch sie auch sind, verdienen den Respekt, den nun einmal menschliche Überzeugungen verdienen, nicht weil sie wahr sind, sondern weil Menschen sich mit ihnen identifizieren. Keinen Respekt verdient die heute verbreitete, meist gar nicht klar artikulierte Ansicht, die Antwort auf diese Frage sei nicht so wichtig, alles andere, was uns bewegt, sei eigentlich wichtiger, und es lohne sich nicht, seine Zeit auf das Nachdenken über Gott zu verschwenden. Wenn es Gott gebe und ein Leben nach dem Tod, so würden wir das ja dann spätestens sehen. Ob jemand ein anständiger Mensch sei, hänge sowieso nicht davon ab, ob er an Gott glaubt oder nicht. Schließlich glaubten die moslemischen Selbstmordattentäter auch an Gott, ja gerade dieser Glaube motiviere sie zu ihren Verbrechen. Ich sage, dass diese Ansicht keinen Respekt verdient. Denn sie zeigt, wie Sokrates einmal sagt, einen sehr kümmerlichen Menschen. Was würden wir von einem Menschen sagen, der aus verzweifelter Lage gerettet und dem Leben zurückgegeben und über dem ein Füllhorn von Wohltaten ausgeschüttet wird, der sich aber im Unklaren darüber ist, ob das ganze Zufall oder das heimliche Geschenk eines liebevollen Menschen ist, und dieser Beschenkte würde sagen: "Diese Frage interessiert mich nicht. Was ich habe, habe ich, und ob dahinter die Liebe eines Gebers steht, ist mir egal, denn ich würde ihm sowieso nicht danken"? Ein Mensch, den wir achten, hat den Wunsch zu danken, wenn es dafür einen Adressaten gibt. Und er würde alles daran setzen, um das herauszufinden.
Und er möchte auch klagen können, wenn es dafür einen Adressaten gibt. Es gibt gewiss verschiedene Motive, die einen Menschen veranlassen, die Frage nach Gott zu stellen. Das tiefste Motiv ist wohl dies: danken können und aus dem Dank leben können. Nicht umsonst ist das Wort für den christlichen Gottesdienst "Dank", Eucharistia. Mit dem Dank verbindet sich die Freude. Eine Annehmlichkeit ohne Geber kann sich mit Befriedigung verbinden. Freude gibt es nur, wo es jemanden gibt, dem man danken kann. Bei den zentralen Fragen des Menschen und bei den Fragen der Philosophie, die diese Fragen methodisch und systematisch erörtert, steht am Anfang, wie bei einem Gerichtsprozess, eine Entscheidung über die Verteilung der Beweislast bzw. der Begründungspflicht. Angesichts der überwältigenden Allgemeinheit und Dauer des Gerüchts von Gott trägt derjenige die Begründungspflicht, der dieses Gerücht als irreführend abtut. Vor allem aber: Wenn wir Spuren eines Wesens suchen, dann ist immer derjenige wichtiger, der eine Spur gefunden hat, als der, der keine gefunden hat. Die Tatsache, dass jemand nie einen weißen Raben gesehen hat, beweist nichts gegenüber dem, der einen gefunden hat. Jener kann nicht sagen: "Es gibt keinen weißen Raben", bloß weil er noch keinen gesehen hat. Wohl aber kann der, der einen gesehen hat, sagen, dass es ihn gibt. Niemand hat Gott je gesehen, schreibt der Evangelist Johannes. Die Frage ist: hat der Regisseur des Films, in dem wir mitspielen, in dem Film selbst seine Signatur mehr oder weniger versteckt hinterlassen, so dass man, wenn man will, sie finden kann?
Das Vermögen der Gottsuche des Menschen ist die Vernunft. Nicht die instrumentelle Vernunft, die uns, wie Nietzsche sagt, zu findigen Tieren macht, sondern das Vermögen, kraft dessen der Mensch seine Umwelt überschreiten und sich auf Wirklichkeit selbst beziehen kann. Das Vermögen, das uns auf See zu wissen erlaubt, dass in dem fernen, kaum wahrnehmbaren Schiff am Horizont, das im Kontext unseres Lebens überhaupt keine Rolle spielt, Menschen sitzen, die ebenso wie wir in der Mitte ihres Blickfeldes sind und für die wir nur am Rand des Horizontes erscheinen und ebenfalls keine Rolle spielen. Glauben, dass Gott existiert, heißt glauben, dass er nicht unsere Idee, sondern dass wir seine Idee sind. Es bedeutet das, wozu Jesus auffordert: Umkehr der Perspektive. Bekehrung. Wenn Gott ist, dann ist das das Wichtigste. Wichtiger, als dass wir sind. Aber dies wissen zu können, macht die Würde des Menschen aus, die ihn von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Es gibt eine große Geschichte der Bemühung von Menschen, ihre Überzeugung von der Existenz Gottes durch rationale Spurensuche zu stützen. Selten ist ein Mensch durch Gottesbeweise zum Glauben an Gott gekommen, obgleich auch dies vorkommt. Aber Pascal lässt mit Recht Gott sagen: Du würdest mich nicht suchen, wenn du mich nicht schon gefunden hättest. Und die Gläubigen haben immer ihre intuitive Gewissheit durch rationale Gründe zu festigen und zu rechtfertigen gesucht. Dass die Gottesbeweise samt und sonders strittig sind, bedeutet nicht viel. Würde von Beweisen innerhalb der Mathematik eine radikale Entscheidung über die Orientierung unseres Lebens abhängen, dann wären auch diese Beweise strittig. Dennoch sind die Gottesbeweise Beweise ad hominem, d.h. sie setzen immer schon einen bestimmten Menschen und bestimmte Voraussetzungen als zugestanden voraus. Leibniz, der wusste, was ein Beweis ist, schreibt einmal, alle Beweise seien Beweise ad hominem. Einen Beweis, der bei dem Adressaten nichts als bereits zugestanden voraussetzt, gibt es nicht, auch nicht in der Mathematik. Die Tatsache, dass die klassischen Gottesbeweise von Aristoteles bis Descartes, Leibniz und Hegel ihre Beweiskraft verloren zu haben scheinen, hängt damit zusammen, dass diese Beweise sämtlich etwas als zugestanden voraussetzen, das zuerst Kant, dann aber vor allem Nietzsche nicht zugestanden haben. Die Frage ist: Was dürfen und müssen wir als zugestanden voraussetzen, um Gründe für den Glauben an die Wirklichkeit Gottes einleuchtend zu finden?
Wenden wir uns zunächst kurz den traditionellen Gottesbeweisen zu. Wir können sie in zwei Gruppen einteilen, den sogenannten ontologischen Gottesbeweis, den der heilige Anselm von Canterbury im 12. Jahrhundert erdacht, den Thomas von Aquin und Kant zurückgewiesen, der aber große Geister wie Descartes, Leibniz und Hegel überzeugt hat. Das anselmsche Argument folgert, ohne auf irgendeine geschaffene Welt Bezug zu nehmen, aus dem bloßen Begriff Gottes seine Wirklichkeit, denn dieser Begriff meint jenes Wesen, über das hinaus nichts Vollkommeneres gedacht werden kann. Mit dem Gedanken eines solchen Wesens aber haben wir bereits die bloße Immanenz unseres Denkens gesprengt und transzendiert, denn, so argumentiert Anselm, ein wirklicher Gott wäre, eben weil er wirklich ist, größer, vollkommener als ein bloß gedachter Gott. Wir müssen Gott also sozusagen per definitionem als wirklich denken. Thomas wendet dagegen ein, dass auch der Gedanke von Gott als einem Jenseits unseres Gedankens Existierendem doch wiederum nur ein Gedanke sei. Ähnlich argumentiert Kant, wenn er schreibt, reale Existenz sei nicht eine Eigenschaft, ein Merkmal, das zu anderen Merkmalen hinzukäme. Es gibt auch im 20. Jahrhundert scharfsinnige Philosophen, die Anselms Argument nach wie vor schlüssig finden und verteidigen. Aber das ist heute nicht mein Thema. Die Argumente des heiligen Thomas, die berühmten "Fünf Wege" kann ich hier noch weniger im Einzelnen vorführen. Sie gehen alle von der Existenz der Welt aus, in der sie Spuren des Schöpfers entdecken. Ich erwähne hier nur zwei dieser Argumente. Das eine, der sogenannte Kontingenzbeweis, geht aus von der Tatsache, dass die Dinge und Ereignisse dieser Welt, aber auch die Naturgesetze, keinerlei innere Notwendigkeit besitzen, alles könnte auch anders sein als es ist. Das Zufällige aber kann es nur auf dem Hintergrund des Notwendigen geben. Es muss einen Grund dafür geben, dass es ist, wie es ist, wenn das Denken nicht kapitulieren soll. Das Sein aber, das aufgrund seiner eigenen inneren Notwendigkeit ist, nennen wir Gott. Der andere Beweis war zu allen Zeiten der volkstümlichste. Er geht aus von der unbezweifelbaren Existenz zielgerichteter Prozesse, wie z.B. des Wachstums von Pflanzen und Tieren, Prozessen, die nur verstehbar sind von ihrem Ende her. So können wir den Flug der Vögel im Winter nach Afrika nur verstehen, wenn wir wissen, dass sie dort Nahrung finden. Aber, so sagt Thomas, die Vögel selbst wissen das nicht, und noch weniger kennt die Pflanze das Programm, das ihr Wachstum steuert. Das Ziel ist nicht im abgeschossenen Pfeil, sondern im Geist des Schützen. Es muss also, um die zielgerichteten Naturprozesse zu verstehen, einen Schützen geben, also einen Schöpfer, der den Dingen die Richtung auf das für sie Gute hineingestiftet hat, denn nur als bewusstes kann ein Ziel sozusagen nach rückwärts wirken und Kausalprozesse in Gang setzen und koordinieren, weil das Bewusstsein des Zieles dem Prozess vorausgeht.
Der erste Schlag gegen die Gottesbeweise wurde von Kant geführt mit der These, dass unsere theoretische Vernunft und ihre konstitutiven Instrumente, die Kategorien, nur dazu geeignet sind, unsere sinnlichen Erfahrungsdaten zu ordnen. Und in diesem Rahmen hat auch die Gottesidee eine systematisierende Funktion. Aber für die theoretische Vernunft gilt doch das Wort Humes: "We never do one stepp beyond ourselves". Die Vernunft ermächtigt uns nicht, etwas über die Wirklichkeit selbst zu sagen und also auch nicht über Gott, insofern er mehr ist als eine Idee. Nur die praktische Vernunft, nur die Gewissenserfahrung veranlasst, ja verpflichtet uns zu der Annahme, die Existenz eines Wesens anzunehmen, das beide Unbedingtheiten, die des Seins und die des Guten, miteinander vereint und garantiert, dass der Lauf der Welt den guten Willen nicht ad absurdum führt. "Ich musste das Wissen einschränken, um für den Glauben Platz zu schaffen", schreibt Kant. Hegel hat dann moniert, dass Kant einen zu eingeschränkten Begriff von Vernunft habe, eingeschränkt nämlich auf die Vernunft der neuzeitlichen Naturwissenschaft, für die, wie ich schon zu zeigen versuchte, Gott kein möglicher Gegenstand sein kann.
Den entscheidenden Schlag aber führte Nietzsche, indem er eine Voraussetzung prinzipiell infrage stellte, die allen traditionellen Gottesbeweisen als zugestanden zugrundelag, die Voraussetzung der Intelligibiltät der Welt. Am kürzesten hat der französische Philosoph Michel Foucault formuliert, was erstmals Nietzsche dachte: "Wir dürfen nicht meinen, dass die Welt uns ein lesbares Gesicht zuwendet." Was Nietzsche prinzipiell infrage stellte, war die Wahrheitsfähigkeit der Vernunft und damit der Gedanke von so etwas wie Wahrheit überhaupt. Dieser Gedanke hat für ihn nämlich eine theologische Voraussetzung, die Voraussetzung, dass Gott ist. Nur wenn Gott ist, gibt es etwas anderes als subjektive Weltbilder, so etwas wie "Dinge an sich", von denen ja noch Kant gesprochen hatte. Es sind die Dinge, wie Gott sie sieht. Wenn es den Blick Gottes nicht gibt, gibt es keine Wahrheit jenseits unserer subjektiven Perspektiven. Nietzsche spricht vom Glauben Platons, der auch der Glaube der Christen ist, dem Glauben, dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist. Die Gottesbeweise kranken also sämtlich an dem, was Logiker eine petitio principii nennen. Diese Beweise setzen genau das voraus, was sie beweisen wollen: Gott. Stimmt das? Ja und nein. Theoretisch stimmt es nicht. Thomas von Aquin setzt zwar bei den "Fünf Wegen" niemals ausdrücklich irgendeine These über die logische Struktur der Welt und die Wahrheitsfähigkeit der Vernunft voraus. Aber er setzt sie stillschweigend voraus. Dass diese Voraussetzung letzten Endes in Gott ihren Grund hat, ist für ihn ontologisch klar, aber das geht in die erkenntnistheoretische Reflexion nicht ein. Wo es um die Frage der Geltung der ersten Prinzipien unseres wahrheitsfunktionalen Denkens geht, da argumentiert er einfach wie Aristoteles mit der reductio ad absurdum des Gegenteils. Wer die Wahrheitsfähigkeit der Vernunft, wer die Geltung des Widerspruchprinzips leugnet, der kann überhaupt nichts mehr sagen. Ja sogar die These, es gebe keine Wahrheit, setzt Wahrheit zumindest für diese These voraus. Sonst landen wir im Absurden. Hier aber setzt Nietzsche ein mit dem Einwand: Wer sagt denn, dass wir nicht im Absurden leben? Zwar verwickeln wir uns damit in Widersprüche, aber so ist es nun einmal. Die Verzweiflung der Vernunft an sich selbst kann sich nicht noch einmal in logisch konsistenter Form artikulieren. Wir müssen lernen, ohne Wahrheit zu leben. Wenn die Aufklärung ihr Werk getan hat, schafft sie sich selbst ab, denn, so schreibt Nietzsche, "auch wir Aufklärer, wir freien Geister des 19. Jahrhunderts leben noch von dem Christenglauben, der auch der Glaube Platons war, dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist". Wenn die Aufklärung sich selbst abgeschafft hat, heißt das Resultat Nihilismus. Dieser aber schafft nach Nietzsches Sicht den notwendigen Freiraum für einen neuen Mythos. Aber auch das kann man natürlich im Grunde nicht sagen, da man Wahres überhaupt nicht sagen kann. Die Frage ist nur noch, mit welcher Lüge man am besten lebt. Man kennt die Geschichte von der Mauerinschrift "Gott ist tot. Nietzsche", unter die jemand schrieb: "Nietzsche ist tot. Gott". Aber etwas bleibt von Nietzsche. Was bleibt, ist der Kampf gegen den banalen Nihilismus der Spaßgesellschaft, ist das genaue und verzweifelte Bewusstsein davon, was es bedeutet, wenn Gott nicht ist. Und was theoretisch bleibt, ist die Einsicht in den inneren und untrennbaren Zusammenhang des Glaubens an die Existenz Gottes mit dem Gedanken der Wahrheit und der Wahrheitsfähigkeit des Menschen. Diese beiden Überzeugungen bedingen einander. Wenn einmal der Gedanke, im Absurden zu leben, aufgetaucht ist, dann ist die bloß erkenntnistheoretische reductio ad absurdum keine Widerlegung mehr. Wir können nicht mehr auf dem sicheren Grund der Wahrheitsfähigkeit des Menschen Beweise für die Existenz Gottes führen, denn dieser Grund ist nur sicher unter der Voraussetzung der Existenz Gottes. Wir können also nur noch beides zugleich haben. Wir wissen nicht, wer wir sind, ehe wir wissen, wer Gott ist, aber wir können nicht von Gott wissen, wenn wir die Spur Gottes nicht wahrnehmen wollen, die wir selber sind, wir als Personen, als endliche, aber freie und wahrheitsfähige Wesen. Die Spur Gottes in der Welt, von der wir heute ausgehen müssen, ist der Mensch, sind wir selbst. Aber diese Spur hat die Eigentümlichkeit, dass sie mit ihrem Entdecker identisch ist, also nicht unabhängig von ihm existiert. Wenn wir, als Opfer des Szientismus, uns selbst nicht mehr glauben, wer und was wir sind, wenn wir uns überreden lassen, wir seien nur Maschinen zur Verbreitung unserer Gene, und wenn wir unsere Vernunft nur für ein evolutionäres Anpassungsprodukt halten, das mit Wahrheit nichts zu tun hat, und wenn uns die Selbstwidersprüchlichkeit dieser Behauptung nicht schreckt, dann können wir nicht erwarten, irgendetwas könne uns von der Existenz Gottes überzeugen.
Denn, wie gesagt, diese Spur Gottes, die wir selbst sind, existiert nicht, ohne dass wir es wollen, wenn auch — Gott sei Dank — Gott vollkommen unabhängig davon existiert, ob wir ihn erkennen, von ihm wissen oder ihm danken. Nur wir selbst sind es, die sich durchstreichen können. Der Begriff der Gottebenbildlichkeit des Menschen, der oft nur als eine erbauliche Metapher benutzt wird, gewinnt heute eine ungeahnt genaue Bedeutung. Gottebenbildlichkeit, das heißt: Wahrheitsfähigkeit. Wobei die Liebe nichts anderes ist als die getane Wahrheit. Liebe kann man ja übersetzen in: Wirklichwerden des Anderen für mich. Kein Begriff hat für die neutestamentliche Botschaft eine so zentrale Bedeutung wie der Begriff der Wahrheit. «Dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit Zeugnis gebe», antwortet Christus auf die Frage des Pilatus, ob er ein König sei. Diese Antwort steht bis heute neben der des Pilatus: «Was ist Wahrheit?» Die Personalität des Menschen steht und fällt mit seiner Wahrheitsfähigkeit. Sie wird heute von Biologen, Evolutionstheoretikern und Neurowissenschaftlern infrage gestellt. Ich kann in die hier aufgebrochene Diskussion nicht eintreten. Nur soviel möchte ich sagen: Jede rein spiritualistische Sicht des Menschen wird heute vom Naturalismus eingeholt. Für den Naturalismus aber ist Erkenntnis nicht das, wofür sie sich hält. Erkenntnis belehrt uns nicht über das, was ist, sondern besteht in überlebensdienlichen Anpassungen an die Umwelt. Aber wie können wir das wissen, wenn wir nichts wissen können? Dass der Mensch ganz und gar Natur, ein natürliches Wesen ist und aus untermenschlichem Leben hervorgegangen ist, das ist für das Selbstverständnis des Menschen nur dann nicht tödlich, wenn die Natur ihrerseits von Gott geschaffen ist und die Hervorbringung des Menschen einer göttlichen Absicht entspricht. Dazu ist es nicht nötig, dass der Evolutionsprozess, den ich lieber mit Darwin als Deszendenzprozess bezeichne, als teleologischer Prozess verstanden wird, d.h. dass in ihm nicht der Zufall der Generator des Neuen ist. Was naturwissenschaftlich gesehen Zufall ist, kann ebenso göttliche Absicht sein wie das, was für uns als zielgerichteter Prozess erkennbar ist. Gott wirkt ebenso durch Zufall wie durch Naturgesetze. Wenn Biologen von «Fulguration» und «Emergenz» sprechen, um das Unerklärbare durch Worte zu beschwören, dann bedeutet an Gott glauben, für dieses Auftreten des Neuen einen Namen zu haben, der das Neue nicht im Grunde nur auf das Alte reduziert, den Namen «Schöpfung». Wahrheitsfähigkeit lässt sich verstehen nur als Schöpfung. Ich möchte das, was ich meine, dass nämlich Wahrheit Gott voraussetzt, an einem letzten Beispiel verdeutlichen, an einem Gottesbeweis, der sozusagen nietzsche-resistent ist, einem Gottesbeweis aus der Grammatik, genauer aus dem sog. Futurum exactum. Das Futurum exactum, das 2. Futur ist für uns denknotwendig mit dem Präsens verbunden. Von etwas sagen, es sei jetzt, ist gleichbedeutend damit, zu sagen, es sei in Zukunft gewesen. In diesem Sinne ist jede Wahrheit ewig. Dass am Abend des 6. Dezember 2004 zahlreiche Menschen in der Hochschule für Philosophie in München zu einem Vortrag über «Rationalität und Gottesglaube» versammelt waren, war nicht nur an jenem Abend wahr, das ist immer wahr. Wenn wir heute hier sind, werden wir morgen hier gewesen sein. Das Gegenwärtige bleibt als Vergangenheit des künftig Gegenwärtigen immer wirklich. Aber von welcher Art ist diese Wirklichkeit? Man könnte sagen: in den Spuren, die sie durch ihre kausale Einwirkung hinterlässt. Aber diese Spuren werden schwächer und schwächer. Und Spuren sind sie nur, solange das, was sie hinterlassen hat, als es selbst erinnert wird.
Solange Vergangenes erinnert wird, ist es nicht schwer, die Frage nach seiner Seinsart zu beantworten. Es hat seine Wirklichkeit eben im Erinnertwerden. Aber die Erinnerung hört irgendwann auf Und irgendwann wird es keine Menschen mehr auf der Erde geben. Schließlich wird die Erde selbst verschwinden. Da zur Vergangenheit immer eine Gegenwart gehört, deren Vergangenheit sie ist, müssten wir also sagen: Mit der bewussten Gegenwart – und Gegenwart ist immer nur als bewusste – verschwindet auch die Vergangenheit, und das Futurum exactum verliert seinen Sinn. Aber genau dies können wir nicht denken. Der Satz «In ferner Zukunft wird es nicht mehr wahr sein, dass wir heute Abend hier zusammen waren» ist Unsinn. Er lässt sich nicht denken. Wenn wir einmal nicht mehr hier gewesen sein werden, dann sind wir tatsächlich auch jetzt nicht wirklich hier, wie es der Buddhismus denn auch konsequenterweise behauptet. Wenn gegenwärtige Wirklichkeit einmal nicht mehr gewesen sein wird, dann ist sie gar nicht wirklich. Wer das Futurum exactum beseitigt, beseitigt das Präsens.
Aber noch einmal: Von welcher Art ist diese Wirklichkeit des Vergangenen, das ewige Wahrsein jeder Wahrheit? Die einzige Antwort kann lauten: Wir müssen ein Bewusstsein denken, in dem alles, was geschieht, aufgehoben ist, ein absolutes Bewusstsein. Kein Wort wird einmal ungesprochen sein, kein Schmerz unerlitten, keine Freude unerlebt. Geschehenes kann verziehen, es kann nicht ungeschehen gemacht werden. Wenn es Wirklichkeit gibt, dann ist das Futurum exactum unausweichlich und mit ihm das Postulat des wirklichen Gottes. «Ich fürchte», so schrieb Nietzsche, «wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben». Aber wir können nicht umhin, an die Grammatik zu glauben. Auch Nietzsche konnte nur schreiben, was er schrieb, weil er das, was er sagen wollte, der Grammatik anvertraute.
Es zählt die Kraft des Arguments
Engelbert Recktenwald, Philosoph und Theologe, hat jetzt zu diesem Streit [zwischen Materialismus und Idealismus] bei Alber eine kleine Sammlung von Aufsätzen veröffentlicht, der auch deshalb eine breite Leserschaft zu wünschen ist, weil ihr Verfasser bemerkenswert scharfsinnig, klug und einleuchtend zu argumentieren begabt ist.
Aus der Rezension meines Buches Wirklichkeitserschließendes Sollen durch Prof. Dr. Christoph Böhr, erschienen in der Ausgabe 1-2/2024 der Zeitschrift für Lebensrecht.
Weitere Beiträge von Robert Spaemann
Prof. Dr. Richard Swinburne: Gibt es einen Gott?
Ist eine Moral ohne Gott möglich?
Gott und die Philosophie
Für die meisten Menschen sei Gott ausschließlich ein Gegenstand des Glaubens und die Philosophie habe nichts mit Gott zu tun, meinte der Philosoph Robert Spaemann in einem Interview, das er dem FOCUS gegeben hat (Ausgabe vom 19. Dezember 2009, S. 40 - 44). Doch das widerspreche einer großen Tradition, “die von Platon über Hegel bis Karl Jaspers zu Wittgenstein und dem großen Mathematiker und Philosophen Whitehead reicht.” Jaspers spreche von einem “philosophischen Glauben an Gott”, der nicht durch Offenbarung begründet sei. “Ob Sie Descartes oder Leibniz nehmen, überall ist die Rede von Gott. Mir scheint es deshalb ganz abwegig, so zu tun, als ob jemand in dem Moment, da er von Gott redet, in die Religion fällt. Denn Gott ist auch ein theoretischer Inhalt.” Für Spaemann wird der Gedanke an Gott dann notwendig, wenn es darum geht, die Innen- und die Außenperspektive des Menschen zusammenzudenken. In der Innenperspektive weiß der Mensch um die Natur seiner Gedanken, die auf Dinge bezogen sind. In der Außenperspektive, wie sie etwa die Hirnphysiologie nahebringt, werden Gedanken zu Vorgängen des Gehirns, die ihrer Intentionalität beraubt werden. Zusammendenken könne man beides nur, wenn man annimmt, “dass die Natur selbst von einem Wesen geschaffen wurde, das eine Innenseite hat und das Wesen schafft, die eine Innenseite haben.”
Gott als Grund der Menschenwürde
“Unser Grundgesetz formuliert es in Artikel 1 klar und deutlich: Die Würde des Menschen ist unantastbar! Damit wird im weltanschaulich scheinbar neutralen Staat ein Begriff der römischen Antike aufgegriffen, den in der Renaissance am Ende des 15. Jahrhunderts der italienische Philosoph Pico della Mirandola deutlich in die Mitte seines christlichen Denkens stellte. Der Mensch hat absolute und nicht einzuschränkende Würde, weil er Ebenbild Gottes ist. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob es Gott wirklich gibt. Es kommt hier zunächst nur auf die Idee »Gott« an, als absolut und transzendent der Welt und ihren Abwägungen von Interessen entzogen. Was also ändert sich unter der Annahme, Gott sei wirklich, und der Mensch, jede Person, sei sein Abbild? Diese absolute Hypothese ist für den Menschen als endlichem Lebewesen, aber begabt mit unendlich ausgreifendem Geist, unbedingt notwendig, weil, wie Dostojewski einmal hellsichtig unterstreicht: Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt! Oder ähnlich später Antoine de Saint-Exupéry: »Denn wenn nichts über dir ist, hast du nichts empfangen. Außer von dir selbst. Was aber erhältst du schon von einem leeren Spiegel?« Oder noch etwas später Max Horkheimer nach den Brutalitäten des Nazi-Regimes: »Einen absoluten Sinn ohne Gott retten zu wollen, ist absurd!«”
Prof. Dr. Peter Schallenberg in Lebensforum 83, 3/2007.
Natürliche und übernatürliche Gotteserkenntnis
In Fortsetzung unserer wöchentlichen Ausführungen über die katechetische Glaubenserneuerung möchte ich eure Aufmerksamekeit heute besonders auf die Frage nach der Erkenntnis Gottes lenken. Es ist die beständige Lehre der Kirche, dass wir Gott nicht nur auf Grund der Offenbarung kennen. Das Zweite Vatikanische Konzil bekennt feierlich, “dass Gott, aller Dinge Ursprung und Ziel, mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen sicher erkannt werden kann” (Dei Verbum, Nr. 6).
Diese sogenannte natürliche Gotteserkenntnis aus der Schöpfung entspricht der geistbegabten Natur des Menschen. Diese befähigt ihn, von den geschaffenen Dingen auf deren Urheber, vom Geschöpf auf den Schöpfer zu schließen und dadurch nicht nur die Existenz Gottes, sondern auch gewisse Eigenschaften seines Wesens zu erkennen. Dies ist der “aufsteigende” Weg der Gotteserkenntnis, der Weg des “Wissens”, der beim Menschen beginnt. Daneben gibt es einen zweiten Weg, den Weg des “Glaubens”, der ausschließlich “von oben”, von Gott seinen Ausgang nimmt. Gemeint ist die Erkenntnis Gottes durch die Offenbarung. Gott hat sich neben dem indirekten Weg über die Schöpfung dem Menschen auch auf direkte Weise mitgeteilt. Er hat ihnen sich selbst eröffnet und der Menschheit “das Geheimnis seines Willens” kundgetan (Eph 1, 9), nämlich seinen Entschluss, den Menschen durch Christus zu erlösen und ihn im Heiligen Geist der göttlichen Natur teilhaftig zu machen. Das Wissen um diesen ewigen Heilsratschluß Gottes kann uns keine menschliche Vernunft vermitteln; wir erhalten es allein durch Gottes eigene Mitteilung und durch unsere gläubige Annahme.
Im Glauben nehmen wir als wahr entgegen, was Gott uns offenbart. Beide Wege, der Weg des “Wissens” und der Weg des “Glaubens”, ergänzen sich gegenseitig trotz ihrer grundlegenden Verschiedenheit. Offenbarung besagt jedoch nicht nur Mitteilung neuer, uns bisher unbekannter Wahrheiten, sondern ist vor allem Selbstmitteilung Gottes an uns. Deshalb ist der Glaube auch nicht nur ein abstraktes “Für-wahr-Halten”, sondern erfordert zutiefst unsere persönliche Hingabe an Gott. Durch den Glauben treten wir zu Gott in ein tiefes persönliches Verhältnis, in eine innige Lebensgemeinschaft mit ihm.
Papst Johannes Paul II. am 27. März 1985 in seiner Ansprache während der Generalaudienz
Gott über uns - Gott mit uns - Gott in uns
Eine Predigt über die Dreifaltigkeit.
Philosophen
Anselm v. C.
Bacon Francis
Bolzano B.
Ebner F.
Geach P. T.
Geyser J.
Husserl E.
Kant Immanuel
Maritain J.
Müller Max
Nagel Thomas
Nida-Rümelin J.
Pieper Josef
Pinckaers S.
Sartre J.-P.
Spaemann R.
Spaemann II
Tugendhat E.
Wust Peter
Autoren
Bordat J.
Deutinger M.
Hildebrand D. v.
Lewis C. S.
Matlary J. H.
Novak M.
Pieper J.
Pfänder Al.
Recktenwald
Scheler M.
Schwarte J.
Seifert J.
Seubert Harald
Spaemann R.
Spieker M.
Swinburne R.
Switalski W.
Wald Berthold
Wust Peter







