zur katholischen Geisteswelt
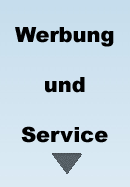
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im philosophischen Bereich.Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
Atheismus
Atheisten
Atheist. Moral I
Atheist. Moral II
Aufklärung
Autonomie
Autonomiebuch
Biologismus
Entzauberung
Ethik
Euthanasie
Evolutionismus
Existenzphil.
Gender
Gewissen
Gewissen II
Glück
Glück und Wert
Gottesbeweis
Gottesglaube
Gotteshypothese
Handlung
Handlungsmotive
Das Heilige
Kultur
Kulturrelativismus
Langeweile
Liebe
Liebe II
Liebesethik
Menschenwürde
Metaethik
Methodenfrage
Moralillusion
Naturalismus
Naturrecht
Naturrecht II
Naturrecht III
Neurologismus
Opferidee
Philosophie
Proslogion
Relativismus
Sinnparadox
Sittengesetz
Sollen
Theodizee
Tierschutz
Verantwortung
Vernunftphil.
Vernunftrettung
Voluntarismus
Werte
Wirklichkeit
Tierschutz und Menschenwürde
Von Prof. Dr. Robert Spaemann
I.
Dass die Unterscheidung zwischen Personen und Sachen keine vollständige Einteilung der Wirklichkeit ist und daß es nicht der “Natur der Sache” entspricht, Tiere unter die Sachen zu rechnen, sagt uns unser Empfinden. Und zwar nicht nur das Empfinden der Empfindsamen. Der Reiter, der sein Pferd beim Rennen schlägt oder ihm nach genommener Hürde den Hals tätschelt, geht davon aus, daß das Pferd in der Weise, wie solche Reize auf es wirken, ihm, dem Reiter selbst, ähnlicher ist als einem Rennauto. Und sogar der sadistische Tierquäler würde nicht tun, was er tut, wenn das Tier eine Sache wäre: Sachen quält man nicht aus Sadismus. Zwar lehrt uns eine bestimmte psychologische Schule, der Behaviorismus, Schmerzen und Wohlbehagen als Mystifikationen zu betrachten; real sei nur das objektiv wahrnehmbare “Schmerz-Verhalten”. Aber diese Theorie wird der Behaviorist spätestens dann vergessen, wenn jemand sich weigert, dessen eigenes Schmerzverhalten als Ausdruck von Schmerz zur Kenntnis zu nehmen. Und wollte er sagen, nur sprachliche Kommunikation könne uns über den Schmerz eines Wesens informieren, so daß wir nur von Menschen wissen können, daß sie leiden, so müßte er nicht nur allen Taubstummen Leiden absprechen, er müßte auch zu der paradoxen Behauptung kommen, daß jener extreme Schmerz, in dem jemand nicht mehr sagt: "Ich habe Schmerzen", sondern nur noch weint oder schreit, gar kein Leiden mehr sei. Nein, gegen diese These soll man nur deshalb nicht argumentieren, weil es nach einer alten Disputationsregel nicht sinnvoll ist, etwas beweisen zu wollen, was für jedermann offenkundig ist. Zu dem Offenkundigen gehört, daß wenigstens höher entwickelte Tiere sich in Lagen befinden können, die wir sinnvollerweise nur mit Worten wie “Schmerz”, “Leiden”, “Lust” und “Sichwohlfühlen” beschreiben können.
Das Gesetz unseres Landes und der meisten zivilisierten Länder erkennt dies übrigens nicht nur an, sondern folgert daraus das Verbot, mit Tieren auf beliebige Weise zu verfahren und ihnen »ohne vernünftigen Grund« Leiden zuzufügen. Lange schon, ehe es einen gesetzlichen Tierschutz gab, zählte man Tierquälerei zu den sittlich verwerflichen Handlungen, die ein anständiger Mensch zu unterlassen, und zu den Sünden, deren ein Christ sich, wenn er sie begangen hat, anzuklagen hatte. Die Begründung hierfür war – unter der Zwangsjacke der Unterscheidung von Personen und Sachen – ebenso tiefsinnig wie inkonsequent: Tierquälerei galt von Augustinus bis Kant deshalb als unsittlich, weil sie den Menschen verroht und ihn auch gegen menschliches Leiden abstumpft. Das ist vermutlich nicht falsch, obgleich hier kein Umkehrschluß erlaubt ist: Die rohesten KZ-Henker konnten mitfühlend zu ihren Hunden sein! Aber warum sollte eine Handlungsweise den Menschen verrohen, wenn sie "an sich" betrachtet nur ein harmloses Vergnügen oder eine sittlich gleichgültige Gedankenlosigkeit wäre? Es handelt sich hier offensichtlich um eine nachträgliche Anpassung der Verurteilung der Tierquälerei durch das sittliche Empfinden an ein vorgefaßtes gedankliches Schema, nach welchem es nur Pflichten gegen Menschen geben kann. Aber schon die Sprache tut hier nicht mit, wenn sie von “Grausamkeit” gegen Tiere spricht. “Grausamkeit” ist ein sittlich verwerfender Ausdruck. Er bezeichnet eine Haltung, die an sich selbst und nicht nur wegen möglicher nachteiliger Nebenfolgen verwerflich ist. Uns faßt eine spontane, durch keinerlei Gedanken vermittelte Abneigung und Empörung gegen jemanden, der ein Tier grausam behandelt. Wenn in Fernsehsendungen gegen Tierversuche solche Grausamkeiten gezeigt werden, so geschieht dies, weil jeder weiß, daß die bloße Sichtbarmachung dessen, was auf diesem Gebiete geschieht, ein wirksames Mittel ist, öffentlichen Unmut dagegen zu mobilisieren (so wie es vermutlich die beste Propaganda gegen Abtreibung wäre, den abgetriebenen Fötus im lebenden Zustand und das, was dann mit ihm geschieht, dem Fernsehpublikum vorzuführen). Es gibt Dinge, die man nur sehen muß, um zu sehen, daß sie nicht sein sollen. Es ist hier nicht der Ort zu zeigen, was es mit diesem unmittelbaren »Sehen« eines Nicht-sein-Sollen auf sich hat, worin es gründet und wie weit es trägt. Zweifellos genügt es nicht für eine endgültige sittliche und rechtliche Urteilsbildung; ohne es hingegen käme eine solche Urteilsbildung gar nicht zustande. Es ist eine notwendige, keine hinreichende Bedingung des sittlichen Urteils.
Diese Einsicht könnte übrigens den Streit beenden zwischen jenen, die solche Fernsehsendungen veranstalten, und jenen, die mit Tierhaltung oder Tierversuchen befaßt sind und daher solche Sendungen kritisieren. Das Argument der letzteren lautet etwa so: “Es ist ja unstrittig, daß die grundlose Quälerei von Tieren unsittlich ist. Dort jedoch, wo menschliche Interessen und Bedürfnisse auf dem Spiel stehen und durch bestimmte Tierexperimente oder durch bestimmte für Tiere leidvolle Weisen der Tierhaltung gefördert werden, da gilt, dass menschliche Interessen vor tierischen Bedürfnissen den Vorrang haben; und es ist unfair, die unmittelbaren Gefühle des Publikums gegen bestimmte Praktiken zu mobilisieren, ohne den Preis zu nennen, den wir für die Unterlassung solcher Praktiken zahlen müßten.” Dieses Argument ist schwach. Gehen wir einmal davon aus, bestimmte Tierexperimente seien unter Umständen bei einer verantwortlichen Güterabwägung zu rechtfertigen, so müßten ja wohl, damit eine solche Güterabwägung überhaupt stattfinden kann, die zur Abwägung anstehenden Güter erst einmal zur Kenntnis genommen werden. Es mag ja sein, daß ich von einer schweren Krankheit mit Hilfe einer bestimmten Therapie auch dann geheilt werden möchte, wenn ich den Preis kenne, den viele Tiere dafür zahlen mußten. Jeden Preis werde ich vielleicht auch in diesem Falle nicht akzeptieren. Außerdem bleibt immer noch die Frage, ob die Versuche, alternative Therapien oder eine alternative Erprobung der praktizierten Therapie zu entwickeln, hinreichend intensiv betrieben wurden. Aber drückt es nicht ein schlechtes Gewissen aus, wenn man sich dagegen wehrt, daß der Preis, den wir die Tiere millionenweise entrichten lassen, überhaupt genannt und lebendig vor Augen geführt wird? Fürchtet man nicht eher, die Güterabwägung könne ganz anders ausfallen, wenn man den Gedanken an den Preis nicht mehr so erfolgreich verdrängen könnte? Fürchtet man nicht, mancher Raucher würde lieber auf das Rauchen oder aber auf eine weitere minimale Verringerung des Raucherrisikos verzichten, wenn er die Schäferhunde sähe, die mit Tabakrauchmasken elend zugrunde gerichtet werden? Und vielleicht fürchtet man auch, daß manche Dame sich mit den bereits vorhandenen Kosmetika begnügen würde, wenn sie wüßte, was mit Tausenden von Hasen geschieht, um neue Kosmetika auf alle möglichen Risiken zu testen. Wie sollen wir zu einer öffentlichen Güterabwägung kommen, wenn uns zwar die Vorteile, die wir uns mit dem Leiden der Tiere erkaufen, vor Augen gestellt, diese selbst uns aber sorgfältig verborgen werden? Ist die übliche Geheimhaltung auf diesem Gebiet nicht ein Zeichen dafür, daß eine verantwortliche Güterabwägung gerade nicht stattfinden soll?
Emotionen ersetzen nicht das sittliche Urteil. Aber ohne eine unmittelbare gefühlsmäßige Wahrnehmung von tierischem Leiden fehlt uns die elementare Wert- und Unwerterfahrung, die jedem sittlichen Urteil vorausgeht. Wir wissen dann gar nicht, worüber wir urteilen. Dies unterscheidet den heutigen Umgang mit Tieren vom archaischen, der, auch wo er grausam war, vor aller Augen stattfand und sich vom Umgang mit Menschen, der auch oft grausam war, nicht fundamental unterschied. Die Perversität der gegenwärtigen Praxis liegt darin, daß wir unsere verfeinerte Sensibilität durch den Umgang mit den Haustieren befriedigen und davon getrennt eine Praxis institutionalisieren, gegen die wir diese Sensibilität abschirmen und in der Tiere einfachhin als »Sachen« behandelt werden. »Ich vermied um jeden Preis, mich denen zu nähern, die umgebracht werden sollten. Menschliche Beziehungen waren mir sehr wichtig« – sagte der KZ-Kommandant von Treblinka!
Das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland schreibt vor, daß Tieren nur »aus vernünftigem Grund« Leiden zugefügt werden dürfen. Das heißt zunächst: Leidzufügung gegenüber Tieren ist rechtfertigungsbedürftig. Und zwar ist das schutzwürdige Gut im Tierschutzgesetz nicht das Eigentum des Besitzers, sondern das Tier selbst. Der Besitzer des Tieres kann in seinem Recht nur durch eine solche Verletzung des Tieres verletzt werden, die dessen Tauschwert mindert oder Kosten verursacht und daher als »Sachbeschädigung« gilt. Der Tierschutz aber gilt dem Tier selbst und schränkt in erster Linie gerade den Besitzer ein. Auch sein Handeln gegenüber dem Tier ist rechtfertigungsbedürftig. Insofern gilt gegenüber dem Tier zunächst das gleiche wie im Falle der Körperverletzung oder der Freiheitsberaubung von Menschen. Auch diese sind unter gewissen Umständen erlaubt, aber nur »aus vernünftigem Grund«, das heißt auch sie sind rechtfertigungsbedürftig. Rechtfertigungsgründe können in diesem Falle sein: Rettung der Gesundheit des Verletzten selbst, so im Fall der Operation; Sühne und Schutz der Gemeinschaft – im Fall der Strafe; Notwehr – im Fall eines Überfalls, Selbstbehauptung eines Gemeinwesens im Fall eines Krieges. Es fällt auf, daß als Rechtfertigungsgründe in diesem Falle nur Gründe in Frage kommen, denen zuzustimmen dem Betroffenen selbst im Prinzip zumutbar ist. Entweder die Schmerzzufügung geschieht ohnehin nur in seinem eigenen Interesse und mit seiner Zustimmung. Oder aber sie trifft ihn als Folge eines verallgemeinerungsfähigen Prinzips, dem er als vernünftiges Wesen zustimmen kann, auch wenn er in diesem besonderen Fall vielleicht die Anwendung dieses Prinzips zu vermeiden wünscht. Mit anderen Worten: Wir dürfen einen Menschen nur Maßnahmen unterwerfen, die seinen Charakter als »Selbstzweck«, das heißt seine Menschenwürde, nicht prinzipiell verneinen.
Sind »vernünftige«, also rechtfertigende Gründe im Fall der Leidzufügung gegenüber Tieren von der gleichen Art? Offenbar nicht. Und zwar deshalb nicht, weil der Begriff der Zumutbarkeit mit Bezug auf Tiere keinen Sinn hat. Die Schmerzen eines Tieres können leicht oder schwer sein. Sie können nicht entweder zumutbar oder unzumutbar sein, weil das Tier nicht imstande ist, seine Bedürfnisse mit Bezug auf Prinzipien der Gerechtigkeit und Verallgemeinerungsfähigkeit zu relativieren, und weil es daher nicht vor der Alternative steht, eigenem Leiden zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Jedes Tier steht unaufhebbar im Zentrum seiner eigenen Welt, aus dem es sich nicht zugunsten einer »objektiven« oder »absoluten« Perspektive verrücken läßt: Tiere können nicht »Gott lieben«. Allerdings können sie sich auch nicht selbst zum Gott machen und sich der objektiven Relativierung ihrer subjektiven Zentralität widersetzen. Diese Relativierung geschieht durch die artspezifischen ökologischen Zusammenhänge, in die Tiere durch instinktive Bedürfnisregelungen eingefügt sind und aus denen sie nicht ausbrechen können und wollen. Arbeitsbienen sind bekanntlich »unterentwickelte« und »unterernährte« Königinnen. Aber sie kommen nicht auf den Gedanken, ihre Emanzipation, die den Untergang der Spezies zur Folge hätte, zu betreiben. Daß sie nicht darauf kommen, ist nicht die Folge eines sittlichen Imperativs, der ihnen gebietet, die Existenz der Art nicht zu gefährden, sondern es ist die Folge der Tatsache, daß sie sind, wie sie sind. Tiere haben keine »Pflichten«. Daher stehen sie auch mit uns nicht in wechselseitigen Rechtsbeziehungen.
II.
Der Mensch ist den Tieren auf zweierlei Weisen überlegen: erstens durch seine Intelligenz und Instinktoffenheit, aufgrund deren er sich von naturhaften Bedingungen fortschreitend emanzipieren und seine Herrschaft über die übrige Natur fortschreitend ausdehnen kann. Ob seine Intelligenz ausreicht, dabei die Bedingungen der eigenen Arterhaltung nicht mit zu zerstören, ist eine offene Frage. Es ist dies im übrigen nicht nur eine Frage der Intelligenz. Zu der Instinktoffenheit des Menschen gehört auch, daß nichts ihn zwingt, die Steigerung seines Wohllebens auf Bedingungen langfristiger Arterhaltung einzuschränken.
Die andere Überlegenheit des Menschen über die Tiere ist nun der ersten genau entgegengesetzt. Sie besteht in der komplementären Fähigkeit, der naturwüchsigen Expansion des eigenen Machtwillens Grenzen zu setzen, einen nicht auf eigene Bedürfnisse bezogenen Wert anzuerkennen, in der Fähigkeit, anderes in Freiheit »sein zu lassen«. Diese »exzentrische Positionalität« des Menschen (Helmut Plessner), diese Fähigkeit, sich sozusagen selbst von außen zu sehen, den eigenen Standpunkt zugunsten eines übersubjektiven zu relativieren – »Liebe Gottes bis zur Verachtung des eigenen Selbst«, sagte Augustinus –, das ist es, was wir »Menschenwürde« nennen. Die Katze weiß nicht, wie der Maus zumute ist, mit der sie spielt. Menschen können etwas, was sie tun möchten und was ihnen nützt, unterlassen, weil und nur weil es einem anderen Wesen schadet oder Schmerzen zufügt. Sie können etwas, was ihnen unerfreulich und schädlich ist, deshalb dennoch tun, weil es einen anderen freut, ihm nützt oder auch, weil der andere einen Anspruch darauf hat. Die Fähigkeit, einen solchen Anspruch zu vernehmen und sich selbst gegenüber geltend werden zu lassen, nennen wir »Gewissen«. Als mögliches Gewissenssubjekt und nur als solches besitzt der Mensch das, was wir »Würde« nennen. Deshalb und nur deshalb, weil er seine eigenen Zwecke relativieren kann, ist er – wie Kant sagt – »Selbstzweck«. Deshalb und nur deshalb, weil er »sich selbst beherrschen« kann, hat er einen Anspruch darauf, nicht zum bloßen Objekt fremder Herrschaft gemacht zu werden. Deshalb, weil er anderem als sich selbst zu wesensgemäßem Dasein verhelfen kann, deshalb weil er einer universalen Verantwortung und Fürsorge fähig ist, hat es Sinn zu sagen, die gesamte Natur sei »seiner Herrschaft unterworfen«.
So lange wir die Rede von Menschenwürde nur als eine Redensart ansehen, mit der die Mitglieder der Spezies homo sapiens ihre Artgenossenschaft absichern, so lange hat diese Rede keinen eigentlich normativen Sinn. Die Spezies verhält sich nach außen wie im Prinzip jede andere Spezies der Natur, nur daß sie aufgrund ihrer Intelligenz ein unvergleichbares Durchsetzungsvermögen besitzt, aufgrund dessen sie sich allmählich jeder »Scheu« entledigen kann. Wenn »Menschenwürde« dagegen etwas meint, was den Menschen »objektiv« auszeichnet, dann kann sie nur die Fähigkeit des Menschen meinen, Ehrfurcht zu haben vor dem, was über ihm, was neben ihm und was unter ihm ist (Goethe). Dann aber macht es gerade die Menschenwürde aus, im Umgang mit der Wirklichkeit deren eigenem Wesen Rechnung zu tragen. Man hat gesagt, die Würde des Menschen sei in seiner Vernunftnatur begründet. Das ist dann richtig, wenn Vernunft nicht nur instrumentelle Intelligenz meint, sondern die Fähigkeit, das, was ist, als es selbst und nicht nur als Bestandteil der eigenen Umwelt aufzufassen. Darum gibt der Mensch den Dingen Namen. Die Katze nennt die Maus nicht »Maus«, sondern frißt sie. Wir dagegen fällen nicht nur Bäume oder nutzen sie zu diesem oder jenem Zweck, wir sagen »Baum« und meinen damit das, was der Baum ist, ehe er etwas »für uns« ist. Nicht als ob wir dieses »Wesen« des Baumes wirklich verstünden. Wir verstehen auch nicht wirklich, wie einer Katze zumute ist. Aber wir sehen, daß sie nicht nur ein Gegenstand ist, den wir sehen, sondern daß wir auch umgekehrt von ihr gesehen werden und daß hinter diesem Blick ein für immer verborgenes Geheimnis liegt, das sich in diesem Blick nur ankündigt.
Nun hindert uns dies nicht, Bäume gleichwohl zu unserem Bedarf oder aber zum Vorteil anderer Bäume zu fällen. Und auch das Töten von Tieren ist zwar rechtfertigungsbedürftig, aber es kann gerechtfertigt werden. Tiere haben kein Selbstverhältnis im Sinne einer Vergegenwärtigung des Ganzen ihres Daseins und des Zusammenschlusses der einzelnen Zustände zu einer zeitübergreifenden Identität. Unsere Pflicht gegenüber der Existenz von Pflanzen und Tieren bezieht sich auf die Existenz der Arten, nicht der Individuen. Zwar sind immer Arten ausgestorben. Aber die Dezimierung lebender Arten, die die zivilisierte Menschheit zur Zeit verursacht, ist eine durch nichts zu rechtfertigende Versündigung an den kommenden Generationen. Wir haben nicht die Pflicht, deren Glück zu planen. Aber wir haben die Pflicht, ihnen den natürlichen Reichtum an Wirklichkeit unvermindert weiterzugeben, nachdem wir für unsere Lebenszeit von den Zinsen dieses Kapitals gelebt haben. Eine Zivilisation, die dazu nicht imstande ist, ist parasitär und dem Schicksal von Parasiten ausgeliefert, die mit ihrem Wirtsorganismus sich selbst zugrunde richten. Insofern gibt es gegen eine solche Zivilisation ein starkes utilitaristisches Argument.
III.
Kein solches Argument gibt es gegen die Leidverursachung bei Tieren. Freude und Schmerz, Leiden und Wohlbefinden sind nicht »objektive« Tatsachen der Welt, die so etwas wie Sinn erst bekommen durch ihre Nützlichkeit oder Schädlichkeit für gegenwärtige oder kommende »Subjekte«. Sie sind vielmehr selbst Erscheinungsformen von Subjektivität. Sie sind nicht primär nützlich oder schädlich für irgend etwas, sondern die Worte »Nutzen« und »Schaden« haben überhaupt erst eine Bedeutung im Verhältnis zu solchen Zwecken wie Freude oder Wohlbefinden. Solche Zustände gehören gar nicht der Welt der Mittel an, sondern der Welt der Zwecke. Von Freude »hat man nichts«, und zwar deshalb, weil »etwas von etwas haben« letzten Endes nur heißen kann: Freude daran haben. Sittlichkeit heißt zuerst und vor allem: freie Anerkennung der Subjektivität, auch wo es nicht die eigene ist. Nun beginnt dort, wo Schmerz beginnt, Subjektivität, also das Inkommensurable, mit keinem Wert aus dem Bereich des Nutzens Verrechenbare. Wo tierische, das heißt apersonale, Subjektivität in unsere Verantwortung gegeben ist, da ist es konstitutiv für die Menschenwürde, diese freie Anerkennung solcher Subjektivität zu vollziehen. Die Parole »Tierschutz ist Menschenschutz« ist zwar nicht falsch, aber oberflächlich. Nicht das eigene Interesse, sondern die Selbstachtung ist es, die uns gebietet, das Leben dieser Tiere, wie kurz oder lang es sein mag, artgemäß und ohne die Zufügung schweren Leidens geschehen zu lassen. Gerade, weil Tiere ihr Leiden nicht in die höhere Identität eines bewußten Lebenszusammenhangs integrieren und so »bewältigen« können, sind sie dem Leiden ausgeliefert. Sie sind sozusagen im Schmerz nur Schmerz, vor allem, wenn sie nicht durch Flucht oder Aggression auf diesen reagieren können. Solche Schmerzzufügung beziehungsweise artwidrige Tierhaltung kann nicht gegenüber irgendeinem anderen Nutzen des Menschen als dem der Vermeidung vergleichbarer Schmerzen oder der Lebensrettung aufgerechnet werden. Wirtschaftliche Vor- und Nachteile dürfen hier gar nicht in Anschlag gebracht werden und wissenschaftliche Forschungsinteressen nur insoweit, als sie unmittelbar auf Lebensrettung oder auf Vermeidung vergleichbarer Schmerzen gerichtet sind. Denn auch wissenschaftliche Interessen finden ihre Grenzen an den allgemeinen Normen der Sittlichkeit und Menschenwürde.
Auch bei wissenschaftlichen Tierversuchen im Dienste menschlicher Gesundheit ist jedoch dreierlei zu beachten:
1. Es darf sich nicht um Versuche handeln, die der größeren Unschädlichkeit von Genußmitteln dienen – also zum Beispiel Tabakwaren oder Kosmetika, welche ihrerseits nicht lebensnotwendig sind. Es widerspricht der Menschenwürde, solchen Genuß mit schweren Leiden von Tieren zu bezahlen. Ein Indiz dafür ist, daß es jedem normal empfindlichen Menschen den Genuß verderben würde, wenn er den Akt der Entrichtung dieses Preises gleichzeitig mit ansehen müßte. Nur die systematische Verheimlichung ermöglicht überhaupt das Vergnügen.
2. Es müssen gleichzeitig zu solchen Versuchen alle Anstrengungen unternommen werden, Ersatzwege für deren Ablösung zu finden. Nach allen Kenntnissen psychologischer und soziologischer Gesetzmäßigkeiten werden solche Anstrengungen im erforderlichen Maße nicht gemacht, solange die abzulösende Praxis nicht deutlich als eben noch geduldetes Provisorium charakterisiert ist. Solange noch große neue Institute errichtet, Gebäude aufgestellt und Planstellen eingerichtet werden, die ausschließlich dem Zweck der Tierversuche dienen, ist es klar, daß hierfür auch die Opfer weiterhin rekrutiert werden. Alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Praxis von Tierversuchen komfortabel auf Dauer zu stellen, sind unvereinbar mit dem entschiedenen Verfolgen des Zieles, sie überflüssig zu machen.
3. Die Maßstäbe für das »unumgängliche Maß« an Leiden müssen neu gesetzt werden, und zwar so, daß dieses »Nur-Leid-Sein« des Tieres nicht den wesentlichen Teil seines Lebens definiert. Das Entstehen von Subjektivität in Form bloßen Schmerzes geschieht dann und wann von Natur als dunkles Schicksal. Ihre bewußte Produktion zu einem wie immer gearteten Nutzen ist mit dem Gedanken der Menschenwürde unvereinbar.
Eine letzte Forderung muß noch genannt werden, die sich aus der Würde des Menschen ergibt. Es wurde oben gesagt, die Würde gründe darin, daß der Mensch sich über seine Interessenperspektiven zu einer Perspektive unparteiischer »Gerechtigkeit« erheben kann. Das heißt nun nicht, daß wir deshalb aufhören würden, Wesen mit subjektiven Interessen zu sein. Diese Interessen können mit der Forderung unparteiischer »Herrschaft« im Einzelfall stark kollidieren. In solchen Fällen ist es wiederum ein Anzeichen für den Besitz von Gewissen, wenn man die eigene Befangenheit bemerkt, in Rechnung stellt und deshalb die Entscheidung im Konfliktfall abgibt. Leider wird bis heute in Sachen des Tierschutzes gegen diese elementare Pflicht der Selbstachtung systematisch verstoßen. Die legitimen Interessen von Wirtschaft, Landwirtschaft und Wissenschaft sind mit denen der Tiere, die von ihnen in Dienst genommen werden, unvermeidlich in potentiellem Konflikt. Der Tierschutz schränkt die Interessenbefriedigung innerhalb dieser Bereiche potentiell ein. Es ist daher unsinnig, den Tierschutz ausgerechnet in einem Ministerium anzusiedeln, in welchem das dominierende und legitimerweise leitende Interesse dem Tier nur unter dem Aspekt seines Nutzens für den Menschen gilt, nicht aber der zu diesem Aspekt quer stehenden, selbst einen ganz anders gearteten »Nutzen« und »Schaden« definierenden Subjektivität des Tieres, die uns als solche gerade nicht nützt, sondern allenfalls freut, und die wir anzuerkennen haben. Für »Anerkennung« zuständig sind die Ministerien des Inneren und der Justiz. Wenn wir davon ausgehen, daß es sich um eine Anerkennung handelt, die nicht eine Rechtsbeziehung konstituiert, sondern die sittliche Substanz der »öffentlichen Ordnung« betrifft, so kann der Ort des Tierschutzes eigentlich nur das Innenministerium sein.
Und schließlich ist es zwar verständlich, aber nicht in einem ehrenvollen Sinn, wenn experimentierende Forscher darauf bestehen, daß sie selbst in »Ethik-Kommissionen«, die über Zulässigkeiten von Tierversuchen entscheiden, die Mehrheit besitzen. Warum? In der Humanmedizin scheinen solche Ethik-Kommissionen in der Tat etwas sehr Fragwürdiges zu sein, weil sie dem Arzt eine Verantwortung abnehmen, die wesentlich zu seinem Arztsein gehört. Er ist als Arzt ja selbst dem Wohl des Patienten verpflichtet. Der Tierexperimentator ist als solcher so wenig primär dem Wohl des Tieres verpflichtet wie der gewerbsmäßige Tierhalter. Er müßte deshalb als sittliches Wesen selbst fordern, daß die Frage der Zulässigkeit seiner Versuche durch Menschen entschieden wird, die nicht durch das primäre Interesse am Versuch und seinen Ergebnissen bestimmt und deshalb insofern nicht befangen sind. Gleiches gilt für die institutionalisierte Wissenschaft. Sie, zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, kann in Fragen dieser Art niemals als unparteiischer Berater und Schiedsrichter auftreten, da sie hier wesentlich Partei ist. Tierische Verhaltensforschung ist zwar von großer Bedeutung für die Erkenntnis dessen, was artgemäßes Leben, tierisches Wohlbefinden ist und welche Faktoren beim Schmerz eine Rolle spielen. Aber die Anerkennung dieser Größen, die Anerkennung tierischer Subjektivität als ein – wenngleich nicht unbedingter – »Zweck in sich selbst«, der unserer Zweckverfolgung, auch der wissenschaftlichen, Grenzen setzt, diese Anerkennung ist ein Akt der Freiheit, ein Akt der praktischen, nicht der theoretischen Vernunft. Wissenschaftler haben hier, wie schon Kant sah, anderen Menschen nichts voraus. Und insofern es gerade ihre Interessen sind, die beschränkt werden, muß ihr Urteil sogar gegenüber dem anderer Menschen zurückstehen. Es würde sie als Menschen deshalb ehren, wenn sie selbst sich für befangen erklärten und die Rolle des Richters in eigener Sache von sich wiesen.
Dieser Text erschien zuerst in: Ursula M. Händel (Hrsg.), Tierschutz. Testfall unserer Menschlichkeit, Frankfurt a. M. 1979, S. 71-81. Wiederabgedruckt in Robert Spaemann, Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns, Stuttgart 22002, S. 467 - 476. Abdruck mit Erlaubnis des Verfassers.
Es handelt sich bei Grenzen um einen Sammelband, der 46 Texte des Philosophen Robert Spaemann vereint. Wer in wichtigen ethischen Grundsatz- und Anwendungsfragen den Durchblick wünscht, dem sei dieser Band sehr empfohlen.
Weitere Beiträge des Philosophen Robert Spaemann
Die Bestimmung des Menschen
In diesem Podcast frage ich nach der Bestimmung des Menschen und der Rolle der Moral in diesem Zusammenhang. Kann sie ein Hindernis sein? Wenn wir die Antworten Kants und des Christentums miteinander vergleichen, können wir die Größe des Christentums neu entdecken.
Philosophen
Anselm v. C.
Bacon Francis
Bolzano B.
Ebner F.
Geach P. T.
Geyser J.
Husserl E.
Kant Immanuel
Maritain J.
Müller Max
Nagel Thomas
Nida-Rümelin J.
Pieper Josef
Pinckaers S.
Sartre J.-P.
Spaemann R.
Spaemann II
Tugendhat E.
Wust Peter
Autoren
Bordat J.
Deutinger M.
Hildebrand D. v.
Lewis C. S.
Matlary J. H.
Novak M.
Pieper J.
Pfänder Al.
Recktenwald
Scheler M.
Schwarte J.
Seifert J.
Seubert Harald
Spaemann R.
Spieker M.
Swinburne R.
Switalski W.
Wald Berthold
Wust Peter







