zur katholischen Geisteswelt
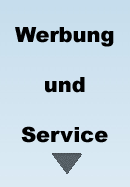
|
Zum
Rezensions- bereich |
|
Zum
biographischen Bereich |
|
Zum englischen
und polnischen Bereich |
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.
Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.
Zum Autorenverzeichnis
Sie befinden sich im ersten Teildes blauen Bereichs des PkG (Buchstaben A bis G)
Zum zweiten Teil
Zum dritten Teil
Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite
|
Zum philosophischen Bereich
|
|
Zum
liturgischen Bereich |
Themen
68er
Abba
Abschuß
Abtreibung
Abtreibung II
Advent
Ägypten
AIDS
Amoris laetitia
Amtsverzicht
Annaverehrung
Antisemitismus
Apokalypse
Ärgernis
Auer Alfons
Auferstehung
Auster
B16 Bundestag
B16 Missbrauch
Barmherzigkeit
Barmherzigkeit II
Barmherzigkeit III
Barmherzigkeit IV
Befreiungstheol.
Beichte
Bekehrung
Belgrad
Benedikt XVI.
Benedikt-Option
Besessenheit
Beten
Bischof
Bischofsamt
Bischofsberater
Bischofsweihen 88
Bischofsweihen II
Borromäusverein
Brigittagebete
Chesterton G.K.
Christenverfolgung
Christkönigtum
Christozentrismus
CiG
Cloyne Report
Corona
Darwinismus
Demokratie
DH
Dialog
Discretio
Dogma
Dogma u. Leben
Doppelwirkung
droben
Drusen
Effetha
Ehe
Ehe und Familie
Einwohnen
Eizellenhandel
Ekklesiologie
Embryo
Emmaus
Papst Franziskus und die Literatur
Papst Franziskus gehörte als Erzbischof von Buenos Aires zum Ehrenkomitee der argentinischen Chestertongesellschaft. In seiner ersten Predigt zitierte er heute Léon Bloy, indem er die Kirche daran erinnerte, sich ganz an Jesus Christus zu halten: “Wer nicht zum Herrn betet, betet den Teufel an.” In Frankfurt studierte er eine kurze Zeit u.a., weil er Guardini schätzt.
Podcast: Amoris laetitia, ein Paradigmenwechsel?
Von Krankenhaus zu Krankenhaus
Während seiner Amtszeit als geistliches Oberhaupt der katholischen Kirche in Argentinien pflegte Bergoglio stets einen bescheidenen, schlichten Lebensstil. Er wohnte allein in einer Wohnung nahe der Kathedrale, benutzte U-Bahn und Omnibusse wie gewöhnliche Bewohner der argentinischen Hauptstadt. Bergoglio mied den Kontakt mit den offiziösen Medien. Nach der schweren Brandkatastrophe in einer Diskothek von Buenos Aires besuchte er die Angehörigen der Opfer und zog von Krankenhaus zu Krankenhaus, um die Verletzten zu trösten. (...) Bergoglio liest gerne Literatur von Dostojewski und Texte des argentinischen Nationaldichters Jorge Luis Borges.
Aus der FAZ online vom 13. März 2012
Erklärung der Petrusbruderschaft zur Wahl des neuen Papstes
Am 14. März 2013 hat das Generalhaus der Priesterbruderschaft St. Petrus zur Wahl des neuen Papstes folgende Erklärung veröffentlicht.
Die Priesterbruderschaft Sankt Petrus freut sich nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. gemeinsam mit der ganzen Kirche von ganzem Herzen über die Wahl von Jorge Mario Kardinal Bergoglio zum obersten Hirten der Kirche. Die Gemeinschaft versichert Franziskus ihres beständigen Gebets für das wichtige Amt, das nunmehr das seinige ist.
Seit ihrer Gründung verbindet die Priesterbruderschaft Sankt Petrus ein besonderes Band mit dem Heiligen Vater, dem Nachfolger des heiligen Apostelfürsten Petrus: „Er ist wirklich der Stellvertreter Christi, das Haupt der ganzen Kirche, der Vater und Lehrer aller Christen.“ (I. Vat. Konzil, dogmatische Konstitution „Pastor aeternus“)
Was uns Papst Franziskus zeigt
Gut zu wissen ist, dass das Lehramt unterschiedliche Stufen der Verbindlichkeit päpstlicher Aussagen kennt. Franziskus zeigt uns ja ziemlich klar, was päpstliche Unfehlbarkeit alles nicht ist.
Aus: Gudrun Sailer, Franziskus und die freie Rede: Der abweichende Papst.
Was die Menschen heraushören
In der Morallehre mahnt Franziskus nicht deshalb zu einer anderen Perspektive, welche die Sexualmoral nicht mehr so fokussiert, weil er sie für unwichtig oder gar falsch hielte, sondern, weil er die Weisheit der christlichen Ethik katholischer Prägung auch wieder in anderen Kontexten fruchtbar machen will, etwa in wirtschaftlichen Fragen. Ihm als Lateinamerikaner fällt es da offenbar leichter als dem Papst aus Deutschland, mit dem Aufruf „Vergiss die Armen nicht!“ bei den adressierten Medienvertretern Gehör zu finden (Ansprache am 16. März), die Barmherzigkeit ins Zentrum zu rücken (Predigt und Ansprache am 17. März) und an Güte und Zärtlichkeit zu erinnern (Predigt am 19. März). Das alles gab es bei Benedikt zwar auch, aber bei ihm, so konnte man den Eindruck gewinnen, hörten die Menschen regelmäßig etwas ganz anderes heraus als bei Franziskus.
Josef Bordat am 2. Oktober 2013 in seiner Besprechung von drei Franziskusbüchern auf seinem Blog jobo72
Das Zitat
Der Glaube ist ein Geschenk von Gott, ein Geschenk, das uns in der Kirche und durch die Kirche gegeben wird.
Papst Franziskus in der Generalaudienz vom 1. September 2013
Kampfansage an die Apparatschiks
„Evangelii Gaudium“ ist ein Sturmwind, der den Staub von den Schreibtischen einer in Bürokratie und Selbstverwaltung erstarrten Kirche bläst. Dieses Schreiben ist eine Kampfansage an jene Apparatschiks in Ordinariaten, Kurien, Gremien, Behörden und Sekretariaten, die Kirche und sich selbst nur mehr verwalten, statt Verkündigung zu gestalten. Die Antwort des Papstes ist eindeutig: Raus aus der Selbstgefälligkeit, rein ins Leben, mit all seinen Sorgen und Leiden, Hoffnungen und Freuden. Nicht Akten auf den Weg, sondern Christus zu den Menschen bringen! Die Kirche der Zukunft wird missionarisch sein oder sie wird nicht mehr sein.
Markus Reder, Chefredakteur der Tagespost, in der Ausgabe vom 28. November 2013
Konzil von Trient
Am 4. Dezember 1563 wurde das 19. Allgemeine Konzil, das Konzil von Trient, das am 13. Dezember 1545 eröffnet worden war und in drei Perioden getagt hatte, feierlich beendet. Die letzten Dekrete wurden von 199 Bischöfen, sieben Äbten, sieben Ordensgeneralen und 19 Prokuratoren unterschrieben.
1969 erschien ein theologischer Sammelband mit dem bezeichnenden Titel Abschied von Trient: Theologie am Ende des kirchlichen Mittelalters. Demgegenüber betont Papst Franziskus die ungebrochene Aktualität des Trienter Konzils in seinem Schreiben an Kardinal Brandmüller, den er zum Delegaten für die Gedenkveranstaltung zum 450. Jahrestags des Abschluss des Konzils ernannt hat: “Im Hören auf eben diesen Heiligen Geist bedenkt die Heilige Kirche unserer Zeit erneut die überaus reiche Lehre von Trient und eignet sie sich an” (“Eundem quidem Spiritum exaudiens, Sancta Ecclesia huius temporis amplissimam Tridentinam doctrinam etiamnum redintegrat et meditatur.”)
Beifall statt Selbstkritik
Zur ganzen Wahrheit gehört leider auch: Franziskus wird gerade in der Kirche deutscher Zunge höchst selektiv wahrgenommen. Jeder pickt sich raus, was ihm passt. Bestes Beispiel: Evangelii gaudium. Würde dieser donnernde missionarische Weckruf auch nur halbwegs ernst genommen, die Kirche in Deutschland stünde vor dem größten Umbau seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ihre Themenagenda und ihre Strukturen würden gründlich überprüft, ob sie in der vom Papst geforderten Weise der Evangelisation dienen. Die Bilanz einer solchen Prüfung wäre ernüchternd. Doch solche Selbstkritik wäre Bedingung für die Wiedergewinnung einer missionarischen Dynamik. Stattdessen: Beifall für Franziskus, Selbstzufriedenheit in deutschen Ordinariaten und der Ruf nach Reformen im Vatikan.
Markus Reder in der Tagespost vom 17. Dezember 2013
Vollblutseelsorger
Ein Erlebnis hat mir die Persönlichkeit von Papst Franziskus nahegebracht und eine anfängliche Reserviertheit aufgelöst: Da unsere Hochschule [Heiligenkreuz] den Namen Benedikts XVI. trägt, war es ein Anliegen unseres Abtes Maximilian Heim, der selbst “Premio-Ratzinger-Preisträger” ist, den neuen Papst Franziskus so schnell wie möglich persönlich kennenzulernen und seinen Segen für den Ausbau unserer wachsenden Hochschule zu erbitten. Die Audienz wurde für mich zu einer Offenbarung, denn bei der persönlichen Begegnung merkte ich sofort, dass Franziskus keinesfalls eine Rolle spielt. Unser Papst inszeniert sich nicht selbst, er ist - ähnlich wie Johannes Paul II. - kein Liebäugler mit den Medien, und wirkt eben deshalb so absolut authentisch. Vor allem ists er ein Vollblutseelsorger. Seine Empathie ist physisch spürbar. Das ist das Geheimnis dieses Papstes, das wir bei seinen endlosen Begegnungen und Segnungen mit den Kranken und Leidenden bestätigt finden: Dieser Papst liebt die Menschen mit der Herzlichkeit, die an den Umgang Jesu mit den Kranken und Sündern im Evangelium erinnert.
Aus: P. Karl Wallner, Evangeliumslust statt Kirchenfrust, in der Tagespost vom 21. Dezember 2013, S. 23.
Nur durch eine unendliche Liebe
Immer wieder macht Franziskus die Schönheit des Evangeliums und die Freude daran spürbar. Über allem steht die Gewissheit, dass unser Leben “nur durch eine unendliche Liebe geheilt werden” kann. (...) In seiner jesuszentrierten Frömmigkeit steht er ganz nah bei seinem Amtsvorgänger Benedikt XVI. Warum spricht gerade diese Verbindung viele, auch Pietisten und Evangelikale, an? Vielleicht weil sie in seinen Worten wie in seinen Umarmungen eine lebendige Einheit von Christusfrömmigkeit und mitfühlender Barmherzigkeit spüren.
Prof. Dr. Thorsten Dietz von der Evangelischen Hochschule Tabor, Marburg, in: IdeaSpektrum vom 4. Dezember 2013
Dezentralisierung auf katholisch
Die Fragen, die von Rom an alle Bischöfe verschickt worden sind, haben sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Doch eines ist klar: Papst Franziskus hat nicht die Lehre der Kirche über Ehe und Familie zur Abstimmung freigegeben. Er hat uns allen eine Aufgabe zur Gewissenserforschung gestellt: Inwieweit ist es uns gelungen, die kirchliche Lehre den Gläubigen wirklich zu vermitteln? Darin besteht die gesunde “Dezentralisierung”. Warum soll immer nur der Papst allein für die Wahrheit in den so entscheidenden Fragen der menschlichen Liebe geradestehen?
Erich Maria Fink und Thomas Maria Rimmel im Editorial zu Kirche heute, Februar/März 2014
Selektive Berichterstattung
Der deutsche Distriktsobere der Petrusbruderschaft, P. Axel Maußen FSSP, hat im Informationsblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus (März 2014) dazu aufgerufen, Papst Franziskus im Original zu lesen, um nicht Opfer journalistischer Manipulationen zu werden. Als Beispiel nannte er die Berichterstattung über die Ansprache des Papstes zum Ad-Limina-Besuch der österreichischen Bischöfe am 30. Januar 2014: “Die Ansprache ist kurz, es lohnt sich, sie im Original zu lesen. Kirchliche Organe in Österreich haben meist in manipulativer Art darüber berichtet: Ausgelassen wird, was mißfällt, was unangenehm ist, was das eigene Tun und vor allem Lassen in Frage stellt. Zwei päpstliche Forderungen aus der Ansprache fielen unter die Zensur der Redakteure: Erstens die gütige, aber auch ernste Aufforderung an die Bischöfe, endlich wieder etwas für eine bessere Beichtpraxis in ihren Bistümern zu tun, und zweitens die Klarstellung, dass Pfarreien nur von geweihten Priestern geleitet werden können. Beides sind Forderungen, die so manchem hiesigen kirchlichen Funktionär gehörig gegen den Strich gehen dürften, weshalb man versucht, sie schnell unter den Tisch zu kehren. Vielleicht hat es ja keiner gemerkt ...”
Eine Stunde Anbetung
Der Heilige Vater möchte mit dem, was er sagt und tut, wirklich zur Substanz vorstoßen, zur lebendigen Begegnung mit Jesus Christus. Er hält jeden Tag eine Stunde Anbetung. Es ist entscheidend, dass der Papst uns darin ein Vorbild ist.
Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Präfekt der Glaubenskongegration, im Interview mit Markus Reder und Guido Horst, Tagespost vom 29. März 2014, S. 13
Genial gegen Gender
Das ist vielleicht das Geniale an dem Schreiben des Papstes: Auf dem Weg über eine Umwelt-Enzyklika schrieb Franziskus genau gegen jene grüne Ideologie an, die die Natur zum Gott erhebt und sich dabei das Unnatürlichste auf die Fahnen schreibt, was es überhaupt gibt: Dass der Mensch sein Geschlecht selber bestimmen könne. Dass der Unterschied zwischen Mann und Frau keine Rolle spielt.
Aus: Guido Horst, Die Unlogik des Westens, erschienen in der Tagespost vom 25. Juli 2015
Gutheißung statt Barmherzigkeit
Papst Franziskus kämpft gegen eine Haltung der Selbstgerechtigkeit, die die eigenen Sünden hinter einer frommen Fassade verbirgt und mit Verachtung auf diejenigen blickt, deren Sünden bekannt sind. Dies scheint ihm ein Herzensanliegen zu sein (vgl. z. B. S. 66, 91 f). Gewiss hat es solche pharisäischen Christen immer gegeben und gibt es sie auch heute noch. Man kann sich jedoch fragen, ob dies wirklich ein zentrales Problem unserer Zeit ist. Ist es nicht eher so, dass selbst viele Christen heute das Bewusstsein der Sünde überhaupt verloren haben? Werden heute nicht Christen als Heuchler und Pharisäer beschimpft, nur weil sie daran festhalten, dass die Sünde eben Sünde ist, auch wenn es ihnen gar nicht darum geht, die Sünder zu verurteilen und zu verachten?
Franziskus erwähnt selbst Papst Pius XII., der gesagt habe, das Drama unserer Zeit liege daran, dass wir das Gefühl für die Sünde verloren hätten. Er geht darauf aber nicht weiter ein, sondern nennt als weiteres Problem den mangelnden Glauben daran, dass es Erlösung und Heilung von den Sünden gibt. Das ist sicher richtig, aber das grundlegendere Problem besteht eben doch darin, dass man nicht mehr von der Sünde sprechen will. In Argentinien mögen die Verhältnisse anders liegen, aber in Europa will jedenfalls ein Großteil der Sünder nicht die Barmherzigkeit, sondern dass die Kirche aufhört, von Sünde zu sprechen. Die Homosexuellen, die in wilder Ehe Lebenden, die dem Gottesdienst Fernbleibenden usw. wollen nicht die Botschaft von der Barmherzigkeit hören, sondern dass die Kirche ihren Zustand gutheißt und segnet.
Pater Matthias Gaudron von der Priesterbruderschaft St. Pius X. in seiner am 29. Januar 2016 veröffentlichten Rezension des Interview-Buches von Papst Franziskus “Der Name Gottes ist Barmherzigkeit”
Beschämung statt Anspruchsmentalität
Viele verlangen von der Kirche mehr Barmherzigkeit, ohne den Weg der Umkehr und Versöhnung mit Gott gehen zu wollen. Für Franziskus ist das ein unmögliches Ding. Er geht davon aus, dass jeder Mensch ein Sünder ist, und nennt sich selbst direkt als erster. Doch gerade erst in der Beschämung über die eigene Unwürde, so sagte er vor den Priestern, wachsen die Würde und die Fähigkeit, die Barmherzigkeit des Herrn zu erlangen und zu erspüren. Mit dem heute üblichen Ton, von der Kirche immer nur zu fordern, hat das nichts zu tun.
Aus: Guido Horst, Alles dreht sich um die Beichte, Tagespost vom 4. Juni 2016
Zum Thema: Barmherzigkeit als Freibrief?
Eheunfähigkeit
Papst Franziskus hält laut Aussage vom 16. Juni 2016 die “große Mehrheit” der kirchlich geschlossenen Ehen für ungültig, und zwar deshalb, weil die Leute nicht wüssten, was das Sakrament ist. “Es ist nicht bekannt, dass es unauflöslich ist, dass es für das ganze Leben ist.”
Wenn dieses Urteil zutreffen sollte, bedeutete es, dass viele Gläubige aufgrund mangelnder Glaubenskenntnis eheunfähig geworden sind. Und das wiederum bedeutete die Bankrotterklärung jener Strömung in der nachkonziliaren Theologie, die für die mangelnde Ehevorbereitung verantwortlich ist: Sie hatte die Mündigkeit des Laien auf ihre Fahnen geschrieben und wollte ihn aus der Vormundschaft des kirchlichen Lehramtes befreien. Das Ergebnis ist nicht Mündigkeit, sondern Eheunfähigkeit.
Auf der anderen Seite hat die Kirche im Normalfall die Ehe der Protestanten immer für gültig gehalten - obwohl diese die Sakramentalität der Ehe leugnen und ihre Unauflöslichkeit lockerer sehen.
Im Inneren leiden
Müller und Sarah sind die einzigen ein Kurienamt ausübenden Kardinäle, die sagen, was sie denken. Ansonsten herrscht im Vatikan eher Stille. Und man muss sich fragen, ob da nicht zwei dem Ausdruck verleihen, was viele denken, aber nicht offen zu sagen wagen. In diesem Pontifikat scheinen diejenigen im Inneren zu leiden, denen Lehre und Liturgie am Herzen liegen und die meinen, mitansehen zu müssen, wie sich Missstände verfestigen. Immerhin: Müller und Sarah reden offen – mehr aber können sie derzeit offensichtlich nicht tun.
Guido Horst in seinem Kommentar Zwei gegen den Strom, Tagespost vom 30. Mai 2017
Der Papst und sein Präfekt
Das war die Zeit [Februar 2014, als Papst Franziskus den Präfekten der Glaubenskongregation Erzbischof Gerhard Ludwig Müller zum Kardinal erhob], als Kardinal Walter Kasper beim nicht öffentlichen Teil desselben Konsistoriums seinen „key note speech“ zum Sakramentenempfang der Wiederverheirateten hielt und damit – auf Wunsch von Papst Franziskus – den quälenden Prozess des Ringens um die Sakramentenpastoral in Gang setzte, der mit „Amoris laetitia“ (formal) endete und in dessen Verlauf Kurie, Kardinalskollegium und Weltepiskopat in zwei Lager zerbrachen. Man kann es drehen und wenden, wie man will, und man muss die einzelnen Stationen dieses Wegs nicht im Einzelnen nachzeichnen, aber von Anfang an zeigte sich: Im entscheidenden Punkt, der dann in zwei Fußnoten des Kapitels acht von „Amoris laetitia“ seinen Ausdruck fand, stand Franziskus auf der einen und sein Glaubenspräfekt auf der anderen Seite.
In der Mitte der ersten Familiensynode, nach der Vorstellung des Zwischenberichts der Synodenleitung durch den ungarischen Kardinal Peter Erdö und Erzbischof Bruno Forte, kam es zum Aufstand in der Synodenaula und der, der am lautesten gegen die doch sehr zielgerichtete Regie der Synodenleitung protestierte, war Kardinal George Pell. Zu Beginn der zweiten Synode gehörte Müller zu den dreizehn Kardinälen, die in einem Brief an den Papst ihre Sorge über diese Form der Synodenregie zum Ausdruck brachten: Die Ergebnisse, so die Schreiber des Briefs, stünden bereits fest und die Teilnehmer der Synode seien bloß Statisten. Franziskus war überaus verärgert und erinnerte in einer zweiten, überraschend gehaltenen Ansprache zur Synodeneröffnung an den päpstlichen Primat.
Es kam „Amoris laetitia“ und der Papst wählte als theologischen Kommentator für die Pressekonferenz zur Vorstellung des Schreibens nicht den Präfekten der Glaubenskongregation, sondern Kardinal Schönborn, den Erzbischof von Wien. Kardinal Müller ließ sich einige Wochen Zeit, um dann von Madrid aus zu bekräftigen, dass auch „Amoris laetitia“ im Lichte des Lehramts von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. gelesen werden müsse. Der Papst und sein Glaubenspräfekt zogen nicht mehr an einem Strang. Als Franziskus schließlich vor einigen Monaten drei langjährige Mitarbeiter der Glaubenskongregation nach Hause schickte, er weder ihnen noch dem Präfekten Müller die Gründe hierfür nennen wollte, und sich der Kardinal in Interviews darüber beklagte, war es nur noch sehr schwer, hier etwas anderes als ein schwerwiegendes Zerwürfnis zwischen den beiden zu vermuten.
Aus: Guido Horst, Abgänge erschüttern Vatikan, Tagespost vom 4. Juli 2017
Kirchlicher Führungsstil
Es ist kein Fortschritt in der Ekklesiologie, sondern ein eklatanter Widerspruch zu ihren Grundprinzipien, wenn alle Jurisdiktion in der Kirche aus dem Jurisdiktionsprimat des Papstes deduziert wird. Auch der große Wortschwall von Dienst, Synodalität und Subsidiarität kann den Rückfall in eine theokratische Konzeption des Papsttums nicht verdecken. Diese Ideale sollte man nicht nur als Desiderate an andere reichen, sondern im vorbildlichen Umgang mit den eigenen Mitarbeiten, besonders den Priestern, täglich selbst beweisen. (...) Die römische Kurie ist die institutionalisierte Mitwirkung der römischen Kirche am petrinischen Primat. Sie kann nicht nach den Kriterien einer multinationalen Stiftung rein weltlich organisiert werden. Das scheint das unaufgelöste Grundproblem im Ansatz von „Praedicate Evangelium“ zu sein. Es rächt sich, wenn bei der Ausarbeitung wichtiger päpstlicher Dokumente die systematische Theologie vernachlässigt und statt klarer dogmatischer Prinzipien eine Kombination von spirituellen Desideraten und weltlichen Machtkategorien den hermeneutischen Grundansatz bestimmt.
Aus: Gerhard Kardinal Müller, Anmerkungen zur Kurienreform in „Praedicate evangelium“, kath.net vom 6. September 2022
Verstörend
Geradezu verstörend aber ist, wenn der Erzbischof [Erzbischof Vincenzo Paglia, Präsident der „Päpstlichen Akademie für das Leben“, der die Berufung von Mariana Mazzucato in die Akademie verteidigt] meint, zwischen „pro choice“ und „pro abtreibung“ unterscheiden zu können und behauptet, Mazzucatos Tweets sei vielleicht „pro choice“, aber nicht „pro abtreibung“. Der Begriff „pro choice“ ist eine Wortschöpfung der Abtreibungslobby. Sie wurde einzig und allein ersonnen, um die Befürwortung von Abtreibungen, sanfter erscheinen zu lassen und so für mehr Menschen zustimmungsfähiger zu machen. Heute würde man von „Framing“ sprechen.
Aus: Stefan Rehder, Ein Irrtum, der korrigiert gehört, in der Tagespost, Oktober 2022. Vergleiche dazu auch den Kommentar von Roland Noé.
Gegen die kuriale Zerstörung
Demütig und furchtlos waren schließlich seine seltenen öffentlichen Stellungnahmen als Papst emeritus: sein Nachruf auf Kardinal Meisner, einen der von Papst Franziskus nicht empfangenen Dubia-Kardinäle, im Juli 2017, den er als furchtlosen Hirten rühmte, der der Diktatur des Zeitgeistes immer widerstanden hatte; sein Brief zur Kirchenkrise nach dem Skandal des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker vom April 2019, in dem er sich nicht scheute, als Hauptursachen den Zusammenbruch der Moraltheologie zwischen 1960 und 1980 und die Rolle der Homosexualität zu benennen und an die Enzyklika „Veritatis splendor“ zu erinnern sowie sein Empfang am 1. August 2019 für Professor Livio Melina, den entlassenen Kopf und langjährigen Präsidenten des Instituts Johannes Pauls II. für Ehe und Familie – ein Protest ohne Worte gegen die kuriale Zerstörung des Instituts. Demütig und furchtlos ist nun sein Heimgang zum Vater. Santo subito.
Manfred Spieker über den verstorbenen Papst Benedikt in der Tagespost vom 5. Januar 2023, Diener der Freude
Welches Modell von Kirche?
Kardinal Müller: Die Kirche ist von Jesus Christus gegründet, und der Papst ist nicht der Herr der Kirche, der morgen ein anderes Modell einführen könnte. Der Papst und auch Theologen können versuchen, bestimmte Aspekte deutlicher herauszustellen und ein größeres Gleichgewicht im Ganzen zu formulieren. Aber das Bischofskollegium mit dem Papst an der Spitze ist nach unserem Glauben von Jesus Christus eingesetzt und wir können nicht von einer hierarchischen, sakramentalen Verfassung der Kirche zu einer synodalen, sprich quasi-demokratischen Verfassung und damit einer Volksherrschaft im politischen Sinn übergehen.
Guido Horst: Was meint denn Franziskus mit Synodalität? Welchen Schritt soll die Kirche für den Papst machen?
Kardinal Müller: Er hat das selber auf mehrmalige Anfragen hin nie geklärt und lässt das sehr weit offen, so dass sich jeder irgendetwas darunter vorstellen kann, was er will.
Gerhard Kardinal Müller im Interview mit der Tagespost.
Römischer Abschied vom Lehramt
Nun hat dieser Geist einen Namen: Es sind Papst, Präsidium und Synodensekretariat, die am Ende festlegen, was der Geist den Gemeinden sagt. Im Glaubensdikasterium soll das zur Methode werden. Abschied vom Lehramt. Stattdessen: Alles frommt. Alles ist relativ. Unterschiedliche Strömungen in Philosophie, Theologie und Pastoral, so der Papst in seinem Brief, sollen nebeneinanderstehen. Ratzinger / Papst Benedikt auf den Kopf gestellt. Es ist eine Revolution von oben. Die Frage ist, ob das kommende Konklave sie fortführen will.
Aus: Eine Revolution von oben, dem Kommentar von Guido Horst über die Ernennung von Victor Fernandez zum Glaubenspräfekten und den Begleitbrief des Papstes zu dieser Ernennung, in: Die Tagespost vom 6. Juli 2023, Seite 8.
Unsichere Lehre
In Fragen der Glaubenslehre zeigt sich Franziskus vielmehr überaus flexibel. Zwar hebt er die Lehre nicht auf, macht sie aber unsicher. Im September hatte der neue Präfekt des Glaubensdikasteriums Franziskus noch ein besonderes persönliches Charisma der Wahrheit bescheinigt – ein Papismus, den man nicht nur im engsten Umfeld des Papstes antreffen kann.
Aus: Helmut Hoping, Der flexible Papst, in der Tagespost vom 12. Oktober 2023
Glaubenshüter, Klimawandel
Wer in dogmatischen, kirchenrechtlichen oder moralischen Angelegenheiten die Wahrheitsfrage stellt, den fordert Franziskus auf, in Prozessen zu denken, Ideal und Wirklichkeit zu unterscheiden, Einzelfälle differenziert zu betrachten – und überhaupt: offen zu sein für die „Überraschungen des Geistes“. Die ihm qua Amt zugedachte Rolle als oberster Glaubenshüter (per definitionem eine konservative, bewahrende Rolle) will er partout nicht spielen. Doch beim Klimawandel wird er plötzlich intransigent. Hier darf es für ihn keine Kompromisse geben.
Aus: Benjamin Leven, “Laudate Deum”: Fern der Kernkompetenz, in der Tagespost vom 19. Oktober 2023
A Pattern
Every pope has personal likes, dislikes, and aggravations. That’s the nature of human clay. As I’ve said elsewhere, and often, Pope Francis has important pastoral strengths that need our prayerful support. But his public complaining diminishes the dignity of the Petrine office and the man who inhabits it. It also disregards the collegial respect due brother bishops who question the Vatican’s current course. And again, it is not of God. Characterizing fidelity to Catholic belief and practice as “fearfully sticking to rules”—the words belong to PBS [Public Broadcasting Service], but the intent is clearly the pope’s—is irresponsible and false. The faithful deserve better than such treatment. It’s also worth noting that heading down “unexplored paths and new roads” can easily lead into the desert rather than Bethlehem. Over the past decade ambiguity on certain matters of Catholic doctrine and practice has become a pattern for the current pontificate.
Aus: Bischof Charles J. Chaput, The Cost of “Making a Mess”, in First Things
Cultural Marxism
Which is why we now have the “cultural Marxism” of campus hothouses, absurdly sensitive about racial and ethnic “micro-aggressions,” but mostly blind to socialist macro-aggressions. Cultural Marxism has roots in Antonio Gramsci, who exerted great influence over Euro-Communism via the notebooks he wrote in a Fascist prison. He developed a concept that he called “capillary culture” – a Marxism so pervasive that, like the capillaries in the body, it would be carried into every nook and cranny of society and therefore be impossible to remove – or resist. Interestingly, he praised the Jesuits during the Counter-Reformation as a model for how to carry out this re-education project. Perhaps that’s why our Jesuit pope says he’s been influenced by him.
Aus: Robert Royal, Reality Is Greater Than Their Ideas, auf The Catholic thing
Themen
EngelEnglandreise
Entmytholog.
Entweltlichung
Erbsünde
Erlösung
Erneuerung
Evangelien
Evangelisierung
Evangelisierung II
Evangelium
Evolution
Exegese
Exerzitien
Exkommunikation
Falschlehrer
Familie
Familiensynode
Fasten
Fasten aus Liebe
Fegefeuer
Fellay B.
Felix culpa
Feminismus
Feuerwehr
Fiducia supplicans
Fis
Flüchtlinge
Frau
Frauen
Frauendiakonat
Freiheit
Freiheit christl.
Freiheit u. Gnade
Fremde Sünden
Freundschaft
Frömmigkeit
FSSP
FSSP II
FSSPX
Führungsversagen
Fundamentalismus
Gebet
Geburt Jesu
Gehsteigberatung
Geistbraus
geistliches Leben
Gender
Genderideologie
Genderkritik
Gender Mainstr.
Generalkapitel 06
Geschlecht
Glaube
Glauben
Glaubensjahr
Glaubensregel
Glaubensschild
Glossen
Gnadenstuhl
Gnadenvorschuss
Goa
Goertz Stephan
Gold
Gott
Gott II
Gottesbegegnung
Gottes Größe
Gottesknecht
Gotteskrise
Gottesvergiftung
Grabeskirche
Gretchenfrage
Guadalupe






